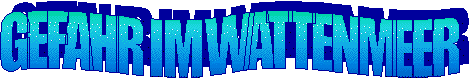
Ein Küstenthriller von Knuth Petersen
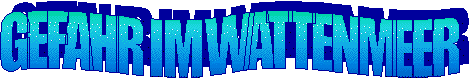
Ein Küstenthriller von Knuth Petersen
Hein Hansen blickte auf die Weite des Wattenmeeres. Die rote Abendsonne spiegelte sich auf großen und kleinen Wasserlachen. Ein kleiner Krebs war dabei, sich vor den Gummistiefeln des jungen Mannes einzubuddeln. Der raue Küstenwind, der jetzt im Herbst arg kühl war, wirbelte Heins schulterlange, blonde Haare durcheinander.
Der Schüler atmete die salzige Seeluft tief ein und blickte zum hundert Meter entfernten Festland zurück. Dort erstreckte sich der Weserdeich scheinbar endlos in beide Richtungen. Der Wall wurde von gewaltigen Findlingen getragen, die Hohlräume zwischen den Steinen waren mit Beton ausgegossen. Auf dem Deichhügel wuchs kniehohes Gras, das sich nun wogend im Wind bewegte. Hein wandte sich wieder zur Wasserseite. Nur leise war das Rauschen der Brandung zu hören. Noch trennte das Watt den Fluss vom Deich, doch die Flut würde bald ihren Höhepunkt erreichen, das Wasser alles bedecken.
Nur Unerfahrene würden sich jetzt noch in die begehbaren Ausläufer vorwagen, denn das Watt war jetzt unberechenbar. Erst im letzten Jahr waren im benachbarten Dorum zwei Mannheimer spurlos verschwunden, die ihre Pension verlassen hatten, um zu einer Nachtwanderung aufzubrechen.
Ein leichter Nieselregen begann und Hein zog sich die Kapuze seines Parkas über den Kopf. Er erinnerte sich noch genau an den Vorfall. Beide Männer tauchten nie wieder auf. Die Polizei hatte sich damals nicht die Mühe gemacht, den schlammigen, schmutzigen Grund der Weser von Tauchern absuchen zu lassen. Zum einem war der Fluss hier viel zu breit, zum anderem schien es unwahrscheinlich, dass die Strömung die Körper von Ertrunkenen nicht ins offene Meer getrieben hätte. Nach zwei Tagen traf eine Polizeihundertschaften aus der fernen Landeshauptstadt Hannover ein. Die Männer durchsuchten das Watt und die in der Umgebung liegenden Felder - ergebnislos. Da eine Straftat nicht auszuschließen war, ermittelte die Kriminalpolizei noch einige Zeit in der Region, ebenfalls ohne jeden Erfolg. Das Watt hat sie geholt, so nannten, es die Einheimischen. Hein aber glaubte zu wissen, dass es anders gewesen sein musste.
Langsam begann sich die rote Abendsonne hinter den Horizont zu schieben. Das monotone Aufschlagen der Wellen wurde lauter. Die Dunkelheit und die See kommen, dachte Hein bei sich.
Der Wind pfiff durch seine Jacke, ihm fröstelte. Keine Möwe ließ ihren Schrei vernehmen, kein Küstenmarder zeigte sich. Ja, selbst die unerschrockene Bisamratte schien sich zurückgezogen zu haben. Seit einigen Wochen hatte der junge Mann das Gefühl, dort draußen im Watt würde etwas Unheilvolles lauern. Eigentlich hielt er dieses Empfinden selbst für irrational, dennoch wurde er den Gedanken nicht los, dass Ebbe und Flut an diesem Ort nicht nur Zyklen der Natur waren, sondern dass sie auch etwas Bedrohliches brachten, etwas, das für den Tod der beiden Mannheimer verantwortlich war, etwas, das wiederkehren würde.
Er versuchte, die düsteren Gedanken zu verdrängen. Mutter wird bereits mit dem Abendessen und einem herrlich heißen Tee auf mich warten, freute er sich. Doch plötzlich hielt er inne. Ihm war, als hätte er eine flüsternde Stimme gehört. Sie schien aus keiner bestimmbaren Richtung zu kommen. Er drehte sich im Kreis, konnte aber im Halbdunkel nichts erkennen. Von der Sonne am Horizont war nur noch wenig zu sehen. Langgezogene Wolken zogen schwerfällig am immer dunkler werdenden Himmel entlang. Das Flüstern wurde eindringlicher. Hein fühlte sich benebelt. Es war ihm jetzt, als sprächen viele Stimmen zu ihm. Sie weckten in ihm den Wunsch, tiefer ins Watt zu gehen, in Richtung Fluss. Eine angenehme Wärme überkam seinen Körper, eine tiefe Zufriedenheit beseelte Hein Hansen und wie von allein setzten sich seine Beine in Bewegung. Er lief auf den Fluss zu, seine Gummistiefel wurden bereits von der Gischt umspült. Hein sank immer tiefer in den Schlamm ein, nur noch wenige Schritte fehlten, bis das Watt keinen Halt mehr bieten konnte. Der steigenden Flut würde der jungen Mann nicht standhalten können. Der starken Strömung hätte er wenig entgegenzusetzen, sie würde ihn mit sich reißen und ihn in die Nordsee zerren, wenn ihn nicht schon vorher ein kräftiger Strudel auf den Grund der Weser zog.
Ein ohrenbetäubender Knall beendete Heins Lethargie - und sein selbstmörderisches Verhalten. Ein Tornado-Düsenjäger des naheliegenden Bundeswehrhorstes Luhnestedt war auf Testflug und hatte dabei die Schallmauer durchbrochen. Hein sah den Kondensstreifen des Kampfflugzeuges am Himmel, atmete tief ein und presste seine Fingernägel in die Handballen. Ein enttäuschtes Gewirr aus Zischlauten und Geflüster kam vom herannahenden Wasser her.
Noch während sich Hein abwandte, um in Richtung Deich zu rennen, hörte er ein jämmerliches Kreischen. Dann klatschte etwas Warmes, Nasses an seine Stirn und fiel gleich darauf ins flache Wasser. Im letzten Licht des Tages erkannte Hein etwas Längliches, Dunkelrotes, das vor seinen Füßen zappelte.
Es hatte kein Fell, und auch keine Haut mehr, aber die langen gelben Nagezähne und der hässliche Schwanz ließen eindeutig erkennen, dass es eine Ratte war. Das gepeinigte, gehäutete Tier lag seitlich im Wasser und bäumte sich unter Schmerzen auf. Die kleinen, schwarzen Augen bildeten einen grausigen Kontrast zu dem rohen Fleisch, in dem sie steckten. Das sterbende Tier schaute den Menschen für den Bruchteil einer Sekunde hilfesuchend an, dann trug eine Welle es fort. Hein unterdrückte einen Würgereiz, drehte sich in Richtung Ufer und rannte los. Er war jung und seine langen Beine trugen ihn schnell. Bald lag der Deich vor ihm - jenes Bollwerk, das die Acker- und Weideflächen, die Dörfer, Tiere und Menschen vor dem Zugriff der See schützt. Hinter dem Deich blieb er stehen und schnappte nach Luft. Nachdem die Seitenstiche verschwunden waren und er wieder halbwegs vernünftig atmen konnte, beeilte er sich, nach Hause zu kommen.
![]()
Hein Hansen schlief diese Nacht nicht besonders gut. Als er schließlich unausgeruht erwachte, war es bereits hell. Die dünnen Vorhänge an den Fenstern hielten die gleißende Morgensonne so gut wie nicht zurück. Unzählige Staubkörnchen tanzten in den Lichtstrahlen, die ins Zimmer drangen. Langsam und gähnend erhob er sich aus seinem Bett. Er streckte sich ausgiebig und zog die Vorhänge auseinander. Der Himmel zeigte sich ausnahmsweise in strahlendem Blau. Unten im Vorgarten stritten sich einige Spatzen lautstark um ein altes Stück Brot. Es war keiner dieser diesigen Küstentage, die Sicht reichte ungewöhnlich weit. Auch der fünf Kilometer entfernte Ochsenturm war zu sehen. Das große, klobige Gebäude, das wie eine Windmühle ohne Flügel wirkte, lag direkt am Deich.
Zum Glück waren Herbstferien, so dass Hein den Tag nach Lust und Laune verbringen konnte. Er hatte sich vorgenommen, nach dem Frühstück zum Ochsenturm zu marschieren, in dem seit vielen Jahren ein alter Kapitän wohnte. Der Name des Alten war Hinnerk von Tönsmann, er wurde aber von der Landbevölkerung ehrfurchtsvoll als Deichgraf bezeichnet. Dieser Titel wurde allen Männern verliehen, die sich mehr oder weniger offiziell um einen bestimmten Abschnitt des Deiches kümmerten. Der Kapitän hatte sich bei Padingbüttel niedergelassen, um hier seinen Lebensabend zu verbringen. Mittlerweile hatte er ein beachtliches Alter erreicht - bald würde er seinen achtzigsten Geburtstag feiern können. Hein zog sich Jeans und ein Sweatshirt an, verließ sein Zimmer und begab sich in die Küche, die im Erdgeschoss lag.
Seine Mutter, eine füllige Frau, saß bereits am Tisch. Nach den vielen Lebensmitteln zu urteilen, die dort herumstanden, war sie bereits beim zweiten Frühstück. Sie schob sich gerade ein Brötchen, dick mit Honig bestrichen, in den Mund. Ihre Finger waren klebrig, am Kinn pappten Brotkrumen. Hein versuchte, nicht hinzuschauen und setzte sich ebenfalls an den Tisch. Seit sein Vater vor drei Jahren bei einem Fähren-Havarie ums Leben gekommen war, ließ Mutter sich gehen. Den größten Teil der knappen Witwenrente investierte sie in Lebensmittel, die sie aus Frust in sich hinein schaufelte.
"Ich habe schon alle Brötchen aufgegessen - bist selber schuld, wenn du so spät aufstehst! Es ist aber noch Brot da, kannst es dir aus dem Schrank nehmen, wenn du etwas davon willst!", sagte sie und schenkte sich Kaffee nach.
Hein verzichtete auf das Brot. Zu seiner Erleichterung stellte er fest, dass von der Milch und den Cornflakes noch etwas übrig war. Er füllte sich eine Schüssel und begann zu essen.
"Ich habe dir die Nordsee-Zeitung gekauft, sind heute viele Stellenanzeigen drin. Jetzt, wo deine Schulzeit bald vorbei ist, wird‘s Zeit, dass du dich nach einer Lehrstelle umsiehst", sagte Heins Mutter, während sie ein Ei köpfte.
"Ich weiß noch nicht, was ich beruflich machen will. Es hat also keinen Sinn, wenn ich mich nach einem Ausbildungsplatz umsehe."
"Das ist vielleicht eine Logik!" Heins Mutter schaute vorwurfsvoll. "Denk mal an die Trine aus deiner Klasse, die ist auch schon untergekommen!"
"Sie hat keinen Ausbildungsplatz, sie wird im Oktober in einer Fabrik anfangen."
Ohne aufzuschauen aß Hein seine Cornflakes weiter. Er dachte an Trine Ehlers, auf die er zur Zeit nicht gut zu sprechen war. Eigentlich war sie seine beste Freundin, doch als er ihr von seinen düsteren Vorahnungen erzählte, hatte sie ihn ausgelacht.
"Aber Sven Tiems, der hat eine richtige Lehrstelle gefunden." Heins Mutter gab noch nicht auf.
"Ja, als Schiffsbauer in Bremen. Das hat keine Zukunft, die Werften werden früher oder später alle schließen!"
"Schiffe werden immer gebaut werden. Wenn die Werft dich nicht interessiert, könntest du auf einem Schiff anheuern - dein Vater ist doch auch zur See gefahren!"
"Ja, und er ist elendig dabei ertrunken!", antwortete Hein unwirsch, er wollte der Diskussion ein Ende bereiten. Als er aber sah, dass seine Mutter Tränen in den Augen hatte, bedauerte er seine Äußerung. Vater war ihr wunder Punkt.
"Tut mir leid, Mutter." Er berührte sie beruhigend am Arm und stand auf. "Ich will heute den Deichgrafen besuchen, bis zum Abend bin ich wieder zurück."
Im Gang schlüpfte er in seine gefütterten Schuhe und zog sich seinen Parka an, denn trotz der Sonne war es draußen sehr kühl. Hein wollte sich noch von seiner Mutter verabschieden, aber sie war im Badezimmer verschwunden. So rief er nur "Tschüs" und ging hinaus. Padingbüttel war ein kleines gepflegtes Dorf, nur das Haus der Hansens hätte einen neuen Anstrich vertragen können - auch der Garten wirkte schäbig.
Hein lief die fünf Minuten zum Deich. Von dort musste man noch einmal knappe zwanzig Minuten gehen, bis der Ochsenturm erreicht war. Es war ein ungewöhnlich kalter Herbst und Hein lief zügig, um sich warm zu halten. Es war nichts von der unheimlichen Atmosphäre des Vortages zu spüren. Die Möwen schimpften wie eh und je, und auf der Weser herrschte reger Schiffsverkehr. Hein dachte daran, wie Hinnerk von Tönsmann, der alte Kapitän, vor Jahren in diese Gegend gekommen und in den leerstehenden Ochsenturm gezogen war. Hein war damals ein kleiner Bub und ging noch in die Grundschule. Der sympathische Tönsmann schloss schnell Freundschaft mit den Kindern aus den umliegenden Dörfern. Oft lud der alte Mann sie sonntags zu einer Flimmerstunde ein: Auf einem altersschwachen und laut brummenden Vorführgerät zeigte er ihnen Filme wie >Zwölf Uhr mittags < oder >Moby Dick<. Letzterer war der Lieblingsstreifen des abgemusterten Seemanns - er rühmte sich damit, ihn schon über fünfzig Mal gesehen zu haben. Nach der Flimmerstunde gab es im Freien Bratwürstchen und kleine Steaks von einem Holzkohlegrill und der Deichgraf verteilte dazu selbstgemachte Limonade.
In den Sommerferien halfen die Jungen und Mädchen dem Deichgrafen oft dabei, seine kleinen Netze aus dem Fluss zu ziehen. Die vielen Krabben und einige zappelnde Fischchen wurden in eine Holzkarre geworfen. Mit einiger Anstrengung wurde diese die Deichböschung hoch und dann bis zum Ochsenturm gezogen. Schließlich landete das Getier auf einem großen Tisch und die Kinder machten sich mit Feuereifer daran, die Krabben zu pulen. Nicht wenige der winzigen rosa Tierchen landeten gleich in den Mündern der Kinder - die meisten aber kamen in Eimer, die in der Mitte des Tisches standen. Die Krabben wurden in Plastiktüten umgefüllt und kamen in eine große Gefriertruhe.
Beim Reinigen des Tisches und der Eimer durfte dem Deichgrafen niemand helfen. Zum Putzen, meinte er immer, gäbe es nichts Hygienischeres als Säure - und die sei nicht für Kinderhände gedacht. Wenn er das brodelnde Zeug hervorholte, mussten Hein und die anderen beiseite gehen. Die unverdünnte Säure hütete der Kapitän wie einen Schatz, kein Kind bekam sie jemals zu sehen.
Wenn alle Krabben gepult, alles aufgeräumt und geputzt war, begann der interessanteste Teil des Tages: Die Kinder setzten sich im Halbkreis um den Deichgrafen und der Alte spann sein Seemannsgarn.
Und er erzählte spannend und gut. Vieles drehte sich um gewaltige Stürme auf hoher See, bei denen er und sein Schiff nur haarscharf am Untergang vorbei segelten.
Andere Geschichten waren herrlich haarsträubender Unsinn: sie handelten von Riesenkraken und anderen Meeresungeheuern, mit denen der Kapitän und seine Mannschaft angeblich gekämpft hatten. Mehrmals erzählte der alte Kapitän von seinem Ringen mit einem Hai, bei dem er nur knapp mit dem Leben davongekommen sei.
Tagelang, so berichtete er, habe er mit schlimmem Wundfieber in seiner Koje gelegen. Als er wieder an Land kam, hätte ein Arzt ihn untersucht und sei erstaunt darüber gewesen, dass jemand diese Verletzungen und einen so hohen Blutverlust überleben konnte. Die Kinder waren sich untereinander nicht einig, ob dies eine der wahren oder der erfundenen Erzählungen ihres Gastgebers war. Genauso verhielt es sich mit den zahlreichen Gruselgeschichten, die er zum Besten gab. In Norddeutschland sind die Menschen traditionsgemäß weniger abergläubisch als jene im Süden des Landes, aber alle Kinder lieben das Phantastische.
Hein und seine Freunde trafen sich einmal die Woche beim Deichgrafen, der für sie zu einer Institution geworden war. Der alte Kapitän fuhr damals jeden Sonntag mit seinem klapprigen Renault-Kombi nach Cuxhaven, um dort seine Krabben und Fische auf dem Wochenmarkt zu verkaufen. Er besserte sich so seine Seemannsrente ein wenig auf. Er hatte einstmals nicht schlecht verdient, doch er war klug genug gewesen, das Geld in jüngeren Jahren zu verjubeln.
"Ich sterbe doch nicht als reicher Greis, um entfernten Verwandten, die ich noch nicht einmal kenne, eine Freude zu machen", meinte er oft.
Mit den Aktivitäten am Ochsenturm war es Mitte der achtziger Jahre vorbei. Der Deichgraf war zwar noch gesund, aber das Alter machte sich hier und da bemerkbar - er unternahm nicht mehr so viel wie früher. Die Kinder wurden größer und hatten andere Interessen. So verlief nach und nach alles im Sande. Aber noch immer wurde der alte Kapitän, der wie eh und je allein im Ochsenturm lebte, regelmäßig von den Dorfbewohnern besucht. Für Hein war der Alte sogar eine Art Großvater geworden. Er schenkte dem Deichgrafen mehr Vertrauen als der eigenen Mutter. Natürlich wusste der Junge, dass vieles von dem Seemannsgarn, das der Deichgraf gesponnen hatte, mehr als weit hergeholt war. Andererseits, so glaubte er, konnten sogar die Gruselgeschichten einen wahren Kern haben.
Er erinnerte sich daran, wie beeindruckt er war, als er den Deichgrafen im Hochsommer einmal mit nacktem Oberkörper Holz hacken sah: Nicht die für einen alten Mann ungewöhnlich muskulösen Arme waren es, die sein größtes Erstaunen hervorriefen, sondern die zahlreichen, teilweise sehr langen Narben, mit denen der Kapitän gezeichnet war. Wenn Hinnerk von Tönsmann seinerzeit nicht in eine schlimme Messerstecherei verwickelt gewesen war, könnte die Geschichte mit dem Hai doch wahr
sein. Für Hein war es nicht ungewöhnlich, den Deichgrafen um einen Rat zu bitten. Auf jeden Fall würde der Alte ihm zuhören, die Erlebnisse und Vorahnungen nicht als Unfug abtun. Hein stoppte. Er war jetzt nur noch wenige Meter vom Ochsenturm entfernt. Der Weg von Padingbüttel bis hierher war ihm kürzer vorgekommen als sonst.
Mittlerweile strahlte die Sonne nicht mehr an einem blauen Himmel - es war trüb geworden. Das Wetter wechselte rasch, wie oft an der Küste. Möglich, dass es in einer halben Stunde tüchtig regnen würde.
Der Ochsenturm stand auf der Landseite, rechts neben dem Deich. Das Gebäude war der Überrest einer ehemals stattlichen Kirche und lag inmitten eines alten, aber gepflegten Friedhofs. Im Sommer diente das Dach des Turms als Aussichts-Plattform für Spaziergänger und Touristen. Hein erreichte die schmale Holztreppe, die vom Deich zum Ochsenturm hinab führte. Vorsichtig stieg er die Stufen hinunter, das Holz der alten Treppe war an manchen Stellen schon arg verfault und brüchig. Die Kreisverwaltung sollte sich bald darum kümmern, sonst könnten Ortsfremde böse stürzen. Unten war es menschenleer. Die umliegenden Dörfer waren ein gutes Stück entfernt und bis zur nächsten Landstraße, die versteckt durch ein Waldstück führte und selbst von der Plattform des Ochsenturms nicht zu sehen war, musste man dreißig Minuten laufen.
Als Hein vor dem über zwei Meter hohen Eingangsportal stand, zog er ein bronzefarbenes Schlüsselbund aus der Jackentasche. Er blickte auf den verrosteten Klingelknopf, der sich rechts neben dem Eingang befand. Hinnerk von Tönsmann war auf einem blechernen Namensschild inmitten vieler Kratzer zu lesen. Hein drehte den Schlüssel im Schloss herum und das hölzerne Tor öffnete sich mit einem langgezogenen Quietschen. Der junge Mann trat ein. In der Halle verbreitete eine schwache Leuchtstoffröhre ihr diffuses Licht. Die Wände des runden Raumes machten den Eindruck, als hätten sie lange keine frische Farbe mehr gesehen. Neben einer leeren Glasvitrine stand ein verstaubter Metallständer, in dem ebenso verstaubte Ansichtskarten steckten: im Sommer verdiente sich der Deichgraf ein kleines Zubrot, indem er den Touristen, die auf den Turm hinaufsteigen wollten, Karten und Souvenirs verkaufte. Eine steile Holztreppe führte zur Aussichts-Plattform. Im hinteren Teil der Halle befand sich eine weitere Treppe - der Zugang zu der bescheidenen Wohnung, die der Ochsenturm zu bieten hatte. Hein stieg diese Treppe hinauf und erreichte den schmalen Gang, der zur Wohnungstür führte. Er klopfte an. Nichts rührte sich. Er schlug nochmals mit den Knöcheln gegen die Tür, diesmal fester. Hinnerk von Tönsmann war nicht mehr der Jüngste, sein Gehör nicht mehr das Beste. Da sich auch jetzt nichts regte, trat Hein ein. Er rechnete damit, den Deichgrafen schlummernd auf der Couch zu finden, doch der Alte saß auf einem Hocker und schaute aus dem offenen Fenster. Zunächst schien er seinen Besucher nicht zu bemerken, dann drehte er sich um.
"Hein! Entschuldige, ich habe dich gar nicht kommen hören. Bin wohl ins Träumen gekommen, als ich aufs Wasser schaute."
"Macht nichts, Herr Tönsmann,, ich habe ja den Schlüssel", sagte Hein und zog sich die Jacke aus. Er durfte den alten Mann jederzeit besuchen. Der Deichgraf wiederum war froh, dass der Junge aus Padingbüttel regelmäßig nach ihm sah.
Hinnerk von Tönsmann erhob sich und schloss das Fenster. Er war fast ebenso groß wie Hein. Inmitten des faltigen Gesichts ragte eine lange Nase hervor. Die stechenden, dunklen Augen des alten Kapitäns schauten stets wachsam umher. Früher musste Tönsmann ein Bär von einem Mann gewesen sein. Auch jetzt beeindruckten seine ungewöhnlich breiten Schultern und die erstaunlich großen Hände. Die Holzdielen knarrten unter seinen Füßen, als er auf Hein zuging, um ihn die Hand zu reichen.
Nachdem er sich auf einer altmodischen Couch niedergelassen hatte, zeigte er auf die kleine Kochnische.
"Wie sieht es aus Hein, machst du uns einen Tee?"
"Gerne." Hein ging zur Kochnische. "Auf dem Weg zu Ihnen habe ich an die alten Zeiten gedacht. Wissen Sie noch, wie wir die Netze einholten, wie wir vor dem Turm gegrillt haben? Auch die tollen Geschichten, die Sie uns dabei erzählten, sind mir wieder eingefallen."
Er stellte die gefüllten Tassen auf den Tisch und setzte sich auf einen Sessel.
"Jaja, die alten Zeiten. Ich denke auch oft an sie", antwortete der Deichgraf.
"Ich frage mich, was an den unheimlichen Geschichten, die Sie früher erzählten, dran war", sagte Hein.
"Da war was dran - eine ganze Menge sogar!" Tönsmann schaute seinen jungen Freund fragend an. "Schon bei deinem letzten Besuch erwähntest du ein ungutes Gefühl, das du bei Spaziergängen am Deich und im Watt verspürst. Bist du deshalb an meinen uralten Gruselgeschichten interessiert?"
"Ja. Ist Ihnen auch aufgefallen, das sich zu bestimmten Zeiten keine Tiere in der Region aufhalten?" Hein hatte den Tee aufgebrüht und stellte jetzt die Kanne und den Zucker auf den Wohnzimmertisch.
Der Deichgraf ging zum Stubenschrank, um für Tassen und Löffel zu sorgen. "Ich habe die Umgebung beobachtet und muss dir recht geben. Es hat sich wirklich etwas verändert. Komm setz dich, beim Tee können wir in Ruhe weiterreden!"
Hein nahm in einem Sessel Platz, Hinnerk von Tönsmann setzte sich auf die Couch.
"Irgendetwas Merkwürdiges geht vor", fuhr der Deichgraf fort, "Es hat mit Ebbe und Flut zu tun, wird durch diese Naturkräfte gebracht und gestärkt. Ich fühle es in meinen alten Knochen, doch ich kann nicht genau sagen, was es ist."
"Gestern Abend habe ich etwas besonders Unheimliches erlebt", sagte Hein und schilderte die bedrohliche Begebenheit im Watt.
Als er geendet hatte blickte der Deichgraf beunruhigt. "Das, was du erlebt hast, war mehr als gefährlich!"
Hein nickte. "Haben Sie eine Vermutung, was das alles zu bedeuten hat? Oder bin ich es, der vollkommen überspannt ist?"
"Rede nicht so töricht daher. Ich kenne kaum jemanden, der klarer im Kopf ist als du." Tönsmann trank vorsichtig von seinem heißen Tee. "Ich wünschte, ich wäre nicht so tatterig, dann könnten wir zusammen der Sache auf den Grund gehen. Ich will aber auf keinen Fall, dass du wieder allein ins Watt gehst."
"Aber dort ist das Geheimnis verborgen. Ich traue mir zwar zu, der Sache ohne Hilfe auf den Grund zu gehen. Doch mir fehlt Ihre Erfahrung. Ich weiß nicht, was ich tun soll, wenn mir etwas Unbekanntes gegenübersteht! Ich hoffte, dass Sie mir weiterhelfen können."
"Gut, dass du zu mir gekommen bist. Vielleicht habe ich etwas Nützliches für dich!" Der Deichgraf lehnte sich zurück "Als ich noch zur See fuhr, kam ich unter merkwürdigen Umständen zu einem Gegenstand."
![]()
Es war Mitte der Zwanziger Jahre. Damals war ich zweiter Steuermann auf einem Dreimaster namens >Alexandra<. Unser Heimathafen lag in den Vereinigten Staaten, in Florida. Du musst wissen, dass dieser US-Staat damals ein wildes und zum Teil unerforschtes Land war. Die Amerikaner hatten das Gebiet von den Spaniern erworben. Das Hafenkaff, in dem wir ankerten, hieß Amerigo. Es war ein Zweihundertseelendorf inmitten von Sümpfen und ausgedehnten Seen. Viele Händler aus dem ganzen Staat hatten sich dort versammelt, um den ankommenden Schiffen ihre Ware abzukaufen.
Die >Alexandra< lief regelmäßig in den Atlantischen Ozean aus, um die Bahamas, Puerto Rico oder Hispaniola anzusteuern. Unser Kahn war auf Kaffee und Rum spezialisiert. Wir erstanden das Zeug auf den verschiedenen Inseln für wenig Geld und verkauften es in Amerigo mit gutem Gewinn weiter. Natürlich gab es damals schon mehr Dampfschiffe als Segler, die Konkurrenz war also groß. So mussten wir flexibel sein und auch sehr kleine Inseln anlaufen, um dort Geschäfte zu machen. Aber die Mannschaft liebte die Arbeit, keiner von den Männern hätte Lust dazu gehabt, im Bauch eines dieser modernen Metall-Ungeheuer Kohlen zu schaufeln.
Die vor uns liegende Seereise ging wieder einmal nach Hispaniola. Wir nahmen zunächst Kurs auf eine vorgelagerte Insel, nur wenige Quadratkilometer groß, die zu Haiti gehörte. Wir hatten ein unverschämtes Glück mit dem Wetter: Die Segel waren stets voll und das Schiff glitt mit einer beträchtlichen Geschwindigkeit durch die Wellen. Eines Morgens, nach nur wenigen Tagen Fahrt, lag das Ziel vor uns. Die Mannschaft verlor keine Zeit und setzte die vier Landungsboote aus. Bei solchen Gelegenheiten gingen von den fünfzehn Besatzungsmitgliedern zwölf an Land und drei blieben als Wachen an Bord.
Besonders auf kleineren Inseln waren Handelsschiffe gern gesehen, denn sie brachten amerikanische Dollars mit, die für die Einwohner einen beträchtlichen Wert darstellten. So wurden die Besatzungen, die ohnehin traditionell gastfreundlich aufgenommen wurden, großzügig mit Essen und Getränken bewirtet. Ich war auf dem Ruderboot, das als erstes den schneeweißen Strand erreichte. Der Blick auf das Innere des Eilandes war durch meterhohe Palmen und dichtes Buschwerk versperrt. Merkwürdig war, dass niemand auftauchte, um uns zu begrüßen. Unser Kapitän, der als einziger Kreolisch sprach, dieses seltsame Gemisch aus Französisch, Spanisch und Afrikanisch, sah sich unruhig um. Er konnte sich das nicht erklären - die Einheimischen hätten uns schon längst bemerkt haben müssen. Besucher nicht zu begrüßen war nicht ihre Art.
![]()
Da der Kapitän die Insel bereits kannte, führte er uns schließlich in das einzige Dorf, wo wir endlich auf die Bewohner trafen. Sie grüßten uns knapp, schienen aber sonst geistig abwesend zu sein. Ja, sie wirkten regelrecht deprimiert. Ich erinnere mich an eine Frau, die auf den Knien vor einem Wassertrog sitzend schmutzige Wäsche schrubbte. Sie machte ein Gesicht, als ob morgen die Welt unterginge. Die Kinder, die in solchen Dörfern meist machen durften, was sie wollten (und es auch taten) waren nicht zu sehen - so, als ob sie allesamt Hausarrest bekommen hätten. Ich dachte, dass es vielleicht einen Todesfall im Dorf gegeben haben könnte. Der Kapitän fand die Hütte des Dorfältesten, der hier die Geschäfte führte und eine Art Bürgermeister war, und trat ein. Wir warteten geduldig vor der Hütte, die recht solide aus Ziegelstein und Bambus gebaut war. Die Stimme des Dorfältesten und unseres Kapitäns waren zu hören, die Verhandlungen schienen nicht gut zu verlaufen. Als die beiden ernst blickend aus der Hütte traten, dachten wir schon, das Geschäft sei ins Wasser gefallen. Doch der Kapitän gab uns ein Zeichen, dass wir ihm und dem Dorfältesten folgen sollten. So gingen wir alle zusammen zum östlichen Rand des Dorfes. Dort standen, geschützt unter einem aus Bambus und Palmen gebauten Stand, rund dreißig Säcke Kaffee und zehn Fässer Rum.
Der Kapitän wandte sich an uns.
"Hört zu, Leute! Die Fässer Sachen gehören jetzt uns. Haut rein und bringt das Zeug zügig an Bord! Die Leute aus dem Dorf bringen uns eine kleine Stärkung. Wenn ihr mit der Arbeit fertig seid - und erst dann - könnt ihr euch bedienen. Nu man tau, Männer!"
Tatsächlich kamen einige Einheimische, die in Körben Früchte und Flaschen herbei trugen Während wir uns ans Abtransportieren machten, ging der Dorfälteste mit ernster Miene in seine Hütte zurück. Zum Glück lag das Dorf nahe am Strand, so dass wir nicht sehr weit zu schleppen hatten. Anstrengender war es da schon, die Ware von unseren Ruderbooten aus ins Schiff zu hieven. Jedes Boot fuhr mehrmals. Als endlich alles geschafft war, konnten die Männer es kaum erwarten, wieder zum Unterstand zu kommen. Die meisten waren nicht besonders wild auf Kokosnüsse oder Ananas, aber den reichlich vorhandenen Maisschnaps und besonders den Rum ließen sie sich schmecken - allen voran unser Kapitän. Ich musste mich enthalten, da ich in der folgenden Nacht die Ruderwache zu übernehmen hatte. Wir wollten noch in der Nacht wieder ablegen, weil wir am nächsten Tag weitere Inseln abzuklappern hatten.
Die Männer tranken bis in die Abendstunden hinein. Langsam begann die Dämmerung. Ich hatte mich indessen zum Schiff übersetzen lassen, um die nötigen Vorbereitungen für die Abfahrt zu treffen. Das Grölen der betrunkenen Matrosen war bis zur "Alexandra" zu hören. Doch auch für die Männer wurde es Zeit aufzubrechen. Ich stand auf dem Vordeck und sah ihnen lachend zu. Sie brauchten eine halbe Ewigkeit, um in die Boote zu kommen. Der Kapitän schrie irgendwelche Kommandos, aber niemand beachtete ihn. Schließlich schafften die Landgänger abzulegen. Da die besoffenen Kerle ziemlich ungleichmäßig ruderten, dauerte es aber recht lange, bis sie zum Schiff kamen.
Der Kapitän hangelte sich als Erster auf die >Alexandra<. Drei Männer folgten ihm. Ollie, der dicke Smutje, kam als nächstes. Er hatte arge Schwierigkeiten mit der Strickleiter und fiel bei seinen Versuchen an Bord zu kommen, dreimal ins Wasser. Schließlich langte es den anderen Männern. Sie zogen ihn zurück ins Ruderboot und wickelten ihm ein Tau um den fetten Wanst. Das freie Ende warfen sie den Leuten zu, die bereits an Deck waren. Fluchend und schnaufend hievten vier Matrosen den durchnässten Koch an Deck. Der Kapitän hatte tatenlos zugesehen. Jetzt lallte er etwas Unverständliches, kotzte über die Reling und taumelte schließlich in seine Kajüte. Ich suchte mir fünf Leute, die man noch die Segel setzen lassen konnte, ohne das sie sich dabei das Genick brachen. Nachdem alles erledigt und der Anker gelichtet war, schickte ich die Männer in die Kojen, wo die anderen bereits ihren Rausch ausschliefen.
Dann war ich der einzige wache und nüchterne Mann an Bord. Die Wellen schlugen leise und gleichmäßig gegen den Schiffsrumpf, aus den Kojen drang das Geschnarche der Betrunkenen. Die Segel hingen schlaff an den Masten, nur ab und zu wurden sie von einer schwachen Windbö bewegt. Unser Schiff machte so gut wie keine Fahrt, es war noch keine Seemeile vom Ufer entfernt. Das Ruder hatte ich auf Kurs gestellt und mit einem Seil festgebunden. Es sah so aus, als ob ich diese Nacht nicht viel zu tun haben würde. Ich holte meine Pfeife aus der Hosentasche, stopfte sie und zündete sie an. Der Himmel war glasklar und die Sterne funkelten auf eine wunderbare Weise.
Als plötzlich ein leiser Schrei ertönte, dachte ich zunächst, einer unserer Männer habe im Rausch schlecht geträumt. Doch der Schrei wiederholte sich, diesmal war er lauter. Die Rufe kamen von Backbord. Ich schnappte mir die Taschenlampe, die neben dem Steuerrad lag, und lief zur Reling. Auf dem Wasser war es stockdunkel, nichts war zu erkennen. Wieder wurde etwas gerufen, es war eine männliche Stimme, die da schrie. Es klang, als sei der Rufer in großer Not. Ich schaltete die Lampe ein und suchte die Wasseroberfläche ab. Ein weiterer Schrei und lautes Geplätscher ließen mich die richtige Stelle finden. Ein Mann, dem Aussehen nach ein Haitianer, paddelte hilflos im Wasser. Er war rund zwanzig Meter entfernt und schien dem Ertrinken nahe. Als er mich sah, rief er etwas auf Kreolisch, was ich nicht verstand. An der Tür zur Kapitänskajüte hing ein mit einem Seil verbundener Rettungsring. Ich rannte so eilig hin, dass mir die brennende Pfeife aus dem Mund fiel. Wieder an der Reling angekommen, warf ich den Ring mit aller Kraft in Richtung des Mannes. Mit einer Hand hielt ich das Seilende fest, mit der anderen Hand richtete ich die Taschenlampe auf das Wasser. Der Ring landete knappe fünf Meter neben dem Haitianer. Er riss die Augen auf, machte aber keine Anstalten sich zu retten. Statt dessen fuchtelte er mit einem länglichen Gegenstand, den er in der rechten Hand hielt, in der Luft herum.
"Schwimm zum Ring oder willst du absaufen, verdammt!?", rief ich auf Englisch, weil ich hoffte, dass er mich so verstehen würde. Gleichzeitig ließ ich die Strickleiter herunter.
Der Mann schien bereits sehr geschwächt zu sein, denn er tauchte unter und kam Sekunden später japsend wieder an die Wasseroberfläche. Ich hatte gehofft, ihn mit dem Seil an Bord ziehen zu können, aber so wie es jetzt aussah, würde ich wohl selbst ins Wasser müssen. Es war mittlerweile eine leichte Brise aufgekommen, die jedoch zu schwach war, um die >Alexandra< in Fahrt zu bringen.
So dachte ich, dass es verantwortbar war, ins Wasser zu springen und den Mann herauszufischen. Die Mannschaft zu wecken hätte keinen Zweck gehabt: Bis die betrunkenen Männer verstanden hätten, worum es ging, wäre alles zu spät gewesen. Um es schnell hinter mich zu bringen, streifte ich die Sandalen ab und sprang ins glücklicherweise warme Wasser. Der Haitianer trieb jetzt mehr, als dass er schwamm. Er war einige Meter entfernt, es schien schlecht um ihn zu stehen. Während ich auf ihn zu kraulte, fiel mir auf, dass er den länglichen Gegenstand immer noch krampfhaft umklammerte. Es gab keine Strömung, der Seegang war kaum der Rede wert. Ich hatte vor, den Mann im Rettungsgriff bis zur >Alexandra< zu bringen und dort mit dem Seil an Bord zu ziehen. Wenige Sekunden, bevor ich ihn erreichte, peitschte ein Schuss durch die Dunkelheit. Aus der Schulter des Haitianers spritzte Blut. Erschrocken riss er die Augen auf und starrte mich an.
"Schnell, Bruder, du nehmen Waffe! Bitte!", rief er mit schmerzverzerrtem Gesicht und warf mir den Gegenstand zu, den er die ganze Zeit umklammert gehalten hatte.
Das Ding landete in meiner Hand - es war ein Stock. Ich schaute mich um, konnte aber nicht herausfinden, woher der Schuss gekommen war. Im selben Augenblick wühlte ein zweiter Schuss das Wasser auf. Der Haitianer schrie vor Schmerz. Die Kugel musste ihn unter der Wasseroberfläche erwischt haben, seine Augen verdrehten sich, bis nur noch das Weiße darin zu sehen war. Ohne einen weiteren Laut von sich zu geben, versank er im Meer.
Ich tauchte, um ihn zu fassen, aber meine Hände griffen ins Leere. Ein zweiter Tauchversuch blieb ebenfalls erfolglos. Es war hoffnungslos und Zeit, aufzugeben. Ohnehin ertönten hinter mir Rudergeräusche und Stimmen - zu sehen war nichts. Das muss das Boot mit den Mördern sein, ging mir durch den Kopf. Es fuhr ohne Beleuchtung, aber dem Lärm der Insaßen nach zu urteilen, befand es sich ganz in der Nähe. Ich sah mich nach der >Alexandra< um und erschrak: Die Außenbeleuchtung war nur noch schwach zu sehen. Mindestens fünfzig Meter war das Schiff bereits abgetrieben und der dafür verantwortliche Wind wurde stärker. Um schnell wieder an Bord zu kommen, schwamm ich, was ich konnte. Dabei wurde ich noch von dem Stock des Haitianers behindert, den ich wie unter Zwang in der Linken hielt. Vollkommen erschöpft erreichte ich endlich mein Schiff und zog mich mit letzter Kraft an der Strickleiter hoch. Aus dem anfänglich schwachen Wind war mittlerweile eine mächtig steife Brise geworden. Das Schiff zog gut an, es machte jetzt so rasante Fahrt, dass kein Ruderboot es mehr einholen konnte.
Von der Mannschaft schien immer noch niemand an Deck gekommen zu sein. Die >Alexandra< lag auf Kurs und entfernte sich schnell von der Küste. Froh darüber, in Sicherheit zu sein, warf ich den Stock auf den Holzboden und setzte mich. Die Tür des Ruderhauses öffnete sich und eine Gestalt trat heraus. Im Licht erkannte ich meinen Kapitän. Er sah zwar noch etwas zerknautscht aus, war aber als geübter Trinker schon wieder halbwegs nüchtern.
"Sag mal, Hinnerk, hast du zur Erfrischung ein Bad in der Nacht genommen, oder was?", fragte er, als er mich pudelnass vor der Reling sitzen sah.
Obwohl sich der Kapitän meist ungehobelt benahm und gegenüber seinen Leuten einen rauen Ton anschlug, so war er kein Unmensch, mit dem man nicht reden konnte.
Ich erzählte ihm also, weshalb ich meinen Posten verlassen hatte und ins Wasser gesprungen war. Er hörte schweigend zu. Als ich geendet hatte, bückte er sich und hob den Stab auf.
"Da es um ein Menschenleben ging, hast du richtig gehandelt, Hinnerk. Schade nur, dass du den Mann nicht retten konntest."
"Wissen Sie, was das für ein Ding ist?", fragte ich ihn und blickte auf mein Mitbringsel.
"Ja, ich denke schon. Hast du schon mal etwas von Voodoo gehört, Hinnerk?"
"Nun, es war die Religion der früheren Sklaven aus Dahomey, sie haben sie nach Haiti mitgebracht", antwortete ich. "Jetzt enthält dieser Glaube auch viele christliche Elemente. Das ganze reicht vom Alltagszauber bis zum Zombiekult."
Der Kapitän nickte. "Auf Haiti wird Zauberei ganz groß geschrieben. Dieses Ding hier sieht zwar aus wie ein Spazierstock, ist aber viel mehr. Es ist das wichtigste Utensil eines Papa-Lois, eines Voodoo-Priesters." Er lehnte sich an einen Segelmast. "Erinnerst du dich an die miserable Stimmung auf der Insel?"
Ich nickte.
Mein Kapitän schaute ernst. "Unser kleines Geschäft wäre beinahe nicht zustandegekommen. Der Papa-Loi hatte dem Dorfältesten eigentlich verboten, Geschäfte zu machen. Dem Voodoo-Priester war nämlich ein heiliges Utensil abhanden gekommen, sein >Katonga<. Mit diesem stabförmigen Gegenstand werden Zaubereien durchgeführt und alle möglichen Dinge gesegnet. Der Älteste meinte, dass ein Geschäft mit uns nichts taugt, wenn der Papa-Loi es nicht gutheißen will. Ich habe schließlich gedroht, nie wiederzukommen, wenn uns weder Kaffee noch Rum verkauft wird. Nach einigem Hin und Her hat der Alte zähneknirschend einem Handel zugestimmt."
"Denken Sie, der Mann, den ich retten wollte, hat diesen Katonga-Stab gestohlen und wollte sich im Schutz der Nacht auf unser Schiff flüchten?"
"Alles deutet darauf hin", meinte der Kapitän.
"Aber warum hat der Kerl sein Leben für einen Stock riskiert?"
"Für uns ist der Katonga ein Stück Holz. Für die Voodoo-Gläubigen aber ist es ein Fetisch, vielleicht sogar ein Heiligtum. Unter Umständen interessierte sich der Papa-Loi einer anderen Insel für das Ding. Oder der Dieb stand in Kontakt mit einen vermögendem Sammler aus den Staaten."
"Aus welchem Grund der Mann den Katonga auch gestohlen haben mag, er musste jedenfalls dafür bezahlen", stellte ich fest.
Der Kapitän nickte. "Für die Inselbevölkerung ist ein solcher Diebstahl ein Sakrileg, denn der Papa-Loi wehrt mit dem Katonga auch böse Geister und Flüche ab. Wie es aussieht, ist der Dieb aufgeflogen. Er wollte mit seiner Beute zur >Alexandra< schwimmen, aber der Papa-Loi und seine Anhänger setzten ihm mit einem Boot nach. Bestimmt waren sie es, die den Mann vor deinen Augen erschossen haben." Er legte die Stirn in Falten. "Jetzt haben wir diesen Katonga-Stab also an Bord. Hoffentlich bringt er uns kein Unglück. Von mir aus kannst du ihn behalten. Besser wäre es aber, wenn du ihn in Florida mit dem nächsten Schiff zurück an den Papa-Loi schicken würdest. Nun mach erst Mal, dass du aus den nassen Sachen kommst! Ich werde Fritjof ans Steuer holen. "
Er reichte mir den Stab. Ich schaute mir die merkwürdigen Schnitzereien darauf an. Zurückschicken, das war leicht gesagt: Wer wusste denn, welches Schiff ausgerechnet auf diese kleine Insel Kurs nahm? Auch dachte ich an den Mann, der mich Bruder genannt hatte. Er vertraute mir diese Waffe unter dramatischen Umständen an und starb für sie. Das bestärkte meinen Entschluss, den Katonga-Stab zu behalten. Der Kapitän verschwand unter Deck und warf meine Ablösung aus der Koje. Er sprach nie wieder mit mir über diese Angelegenheit.
Wir liefen noch andere Inseln an, auf denen die Geschäfte wie gewohnt verliefen. Die Rückreise dauerte etwas länger als die Hinfahrt, denn der Wind zeigte sich launisch. Wie erwartet, bekamen wir nach der Landung in Amerigo gutes Geld für die mitgebrachte Ware.
Ich beschloss, dass dies meine letzte Fahrt mit der >Alexandra< gewesen sein sollte, denn ich hatte das subtropische Florida und das Befahren des Karibischen Meeres satt. So musterte ich ab, packte meine Siebensachen samt dem Katonga und nahm das nächste Schiff nach New York. Die winterliche Kühle dort war eine angenehme Abwechslung. Vom Ersparten, was nicht wenig war, ließ ich es mir gut gehen. Mit Mantel, Schal und dem Stock aus Haiti stolzierte ich am Broadway und der Fifth-Avenue herum. Vor der Damenwelt prahlte ich mit der Geschichte des Katonga-Stabes. Ein halbes Jahr New York reichten mir, dann zog es mich wieder nach Europa zurück. Ich machte in Hamburg mein Kapitänspatent und dachte nicht mehr an die Waffe aus Haiti - sie verschwand in einer Truhe. Erst jetzt, wo meine Beine nicht mehr so recht wollen, habe ich sie wieder hervorgeholt und mir den Katonga als Gehstock herausgenommen.
![]()
Hein hatte fasziniert zugehört. Nun schaute er ungläubig, denn der Deichgraf gab ihm den Katonga-Stab. Der alte Mann lehnte sich wieder zurück. "Wenn du wieder ins Watt gehst, möchte ich, dass du dieses Ding zu deinem Schutz mitnimmst. Wenn es dort eine Bedrohung gibt, kann dir der Katonga möglicherweise eine Hilfe sein"
"Aber Sie brauchen ihn doch!"
"Ach was", der Deichgraf winkte ab. "Ich habe noch andere Spazierstöcke. Es sind zwar keine mit einer vergleichbar interessanten Vergangenheit, aber ihren Dienst tun sie auch."
"Und Sie meinen wirklich, dieser Stock könnte gegen Übernatürliches eine wirkungsvolle Waffe sein?"
"In späteren Jahren bin ich noch einmal nach Haiti gekommen. Bei dieser zweiten Reise war es keine vorgelagerte Insel, sondern die Hauptstadt Port-au-Prince. Dort begegnete ich einigen Männern, die von sich behaupteten, Voodoo-Priester zu sein. Die meisten waren Schwindler, die den Touristen Liebestränke, Amulette oder nur Hasch andrehen wollten. Es gab aber auch welche, die in Ekstase Rituale durchführten, die eindeutig auf Magie beruhten. Diese Männer hatten stets einen solchen oder zumindest einen ähnlichen Stab bei sich. Ich halte es gut für möglich, dass dem Katonga magische Kräfte innewohnen."
Donnergrollen war zu vernehmen und der Regen prasselte lautstark gegen die Scheiben. Hein hielt den Katonga ehrfurchtsvoll in den Händen. "Vielen Dank, ich weiß das sehr zu schätzen! Hoffentlich bringe ich das Ding heil wieder zurück."
"Mach dir darum keine Sorgen, mein Junge! Hauptsache, du kommst gesund wieder. Ich kann dich gut verstehen, an deiner Stelle würde ich der Sache auch nachgehen. Ich wünschte, ich könnte dir helfen. Aber leider bin ich zu alt, um dich zu begleiten."
Hein wollte gerade antworten, als an der Haustür geklingelt wurde.
"Das wird Trine Ehlers sein, sie wollte noch einige Konserven für mich vorbei bringen", sagte der Deichgraf.
"Ich lasse sie rein." Hein stand auf und stieg ins Erdgeschoss hinab.
Kurze Zeit später stand er mit der jungen Frau im Wohnzimmer. Sie hatte ihren Regenmantel unten in der Halle gelassen. Trine Ehlers trug ihre schwarzen Haare, von denen jetzt glänzende Wassertropfen in ihr hübsches Gesicht hinab perlten, sehr kurz. Hein verschwand, um sich aus dem Badezimmer ein Handtuch zu besorgen.
Der Deichgraf schaute besorgt. "Trine, du hättest bei dem Sauwetter nicht kommen sollen! Wirst dir noch eine Lungenentzündung holen, wenn du ständig im Regen unterwegs bist!"
"Ich werd‘s schon überleben", lachte sie. "Außerdem: Wer soll unserem alten Seebär Proviant bringen, wenn nicht ich?"
Hein kam mit dem Handtuch wieder, und Trine wischte sich das Gesicht trocken. Ihre grünen Augen funkelten vergnügt, als sie sich auf die Couch setzte. Sogar jetzt im Herbst war ihre Stupsnase mit zahlreichen Sommersprossen bedeckt.
"Stell dir vor, Hein, die Deern hat Angst, dass ich hier in meinem alten Turm an Skorbut eingehe. Na, Trine, nimm dir erst mal eine Tasse aus dem Schrank! In der Kanne dürfte noch Tee sein, der tut dir jetzt gut."
Während sich das Mädchen den Tee einschenkte sah Hein aus dem Fenster.
"Sieht aus, als ob ein Sturm aufzieht. Besser, wir gehen bald zurück nach Padingbüttel", meinte er.
Trine Ehlers schaute ihn verwundert an: "Hast du dem Deichgrafen dein Seemannsgarn vom schwarzen Mann erzählt und nun Angst, ohne mich nach Hause zu gehen?"
"Sehr lustig, aber wenn du unbedingt durch ein Unwetter laufen möchtest - bitte schön!" Hein ärgerte sich über sich selbst. Es war wirklich ein Fehler gewesen, auch ihr von seinen Gedankengängen zu erzählen.
"Kinder, streitet euch nicht!", schaltete sich der Deichgraf ein. "Trine, der Hein hat Recht: Bevor es düster und stürmisch wird, solltet ihr euch auf den Heimweg machen. Ich gebe euch sicherheitshalber meine Taschenlampe mit. Hoffentlich geben die Batterien noch genug her, um euch beiden heimzuleuchten."
"Das ist nett von Ihnen, Herr Tönsmann. Besser wir gehen jetzt gleich, der Regen hat gerade etwas nachgelassen!" Hein stand noch immer am Fenster. Über den Deich hinweg sah er, dass die Ebbe ihren Tiefpunkt erreicht hatte. Das Wasser schien so fern. Die Sonne ging langsam unter, das Watt wirkte silbrig-schwarz.
"Meinetwegen, wenn sich der Lütte nicht allein nach Hause traut, werde ich mich wohl auch wieder auf den Weg machen müssen." Trine stellte ihre halb ausgetrunkene Teetasse ab und lächelte spöttisch.
Hein wollte eigentlich etwas erwidern, statt dessen sagte er in Richtung des Deichgrafen: "Ihre Taschenlampe ist unten, in der Vorhalle. Ich nehme sie nachher mit."
"Wunderbar, dann kann ich ja hier oben bleiben." Der Deichgraf wandte sich an Trine: "Besten Dank für den Schiffszwieback, den du trotz hohen Seegangs hierher bugsiert hast, mein Deern. Aber tu mir den guten Hein nicht immer so bannig ärgern!"
"Na gut." Sie zwinkerte. "Ich werd‘ mir Mühe geben."
Hein trug mittlerweile wieder seinen khakigrünen Parka. Die Kapuze hatte er fest um seinen Kopf geschnürt, denn draußen war es nass und windig.
"Sieht er nicht gediegen aus, fast wie ein Bundeswehrlehrling?", konnte sich Tine nicht verkneifen.
"Trine, du hast mir doch versprochen, Hein nicht mehr aufzuziehen!", mahnte der Deichgraf.
Hein ignorierte Trine und verabschiedete sich von dem alten Kapitän: "Den Stock nehme ich morgen mit. Nochmals vielen Dank für Ihre Hilfe!"
Trine schaute fragend. "He, ihr beiden, was habt ihr denn da ohne mich besprochen?"
Der Deichgraf lächelte. "Das ist und bleibt ein Geheimnis. Tschüs, Kinder."
![]()
Dunkle Wolken zogen über den Deich. Der Regen nieselte auf die jungen Leute nieder, der Wind zerrte an ihrer Kleidung. Seitdem Hein das Portal des Ochsenturms hinter sich ins Schloss hatte fallen lassen, war ihm mulmig zumute. Der Deich-Weg in Richtung Padingbüttel war nur ein unbeleuchteter Trampelpfad. An heißen Sommertagen wanderten hier oft Schulklassen aus Bremerhaven entlang. Die Stadtkinder fürchteten sich mitunter vor den Kühen, die während der warmen Monate friedlich auf der Böschung grasten. Vor den harmlosen Wiederkäuern brauchte sich wirklich niemand fürchten, aber in Anbetracht des unfreundlichen Wetters empfand Hein es durchaus als beklemmend, hier entlang laufen zu müssen.
Die Taschenlampe warf einen weißen Kegel in die Dunkelheit. Hein leuchtete den Deich entlang zur Landseite hinunter. Das Licht reichte bis zu einem abgeernteten Getreidefeld. Inmitten der schwarz-braunen Erde standen unzählige abgetrennten Halme, sie wirkten wie Fremdkörper in dem von Traktorspuren durchfurchtem Boden.
"Was suchst du denn da unten? Dort gibt es höchstens ein paar Feldmäuse. Auf die Wasserseite musst du leuchten, da lauert der schwarze Mann!", stichelte Trine.
"Du kannst es wohl nicht lassen? Ich hätte dir gegenüber nie erwähnen sollen, dass hier etwas nicht stimmt. Wenn du besser beobachten würdest, könntest du bemerken, dass es hier eben keine Mäuse gibt."
"Du und dein übersinnlicher Tüddelkram. Wahrscheinlich waren die Bauern beim Ausbringen der Pestizide wieder besonders eifrig!"
"Ich habe nicht von übersinnlichen Phänomenen gesprochen. Gefühl und Intuition sagen mir, dass es hier nicht mit rechten Dingen zugeht."
Hein wechselte auf die andere Seite des Weges und leuchtete zur Wasserseite hinunter. Er konnte den grauen Schlick des Watts erkennen. Das Aufschlagen der Wellen klang noch weit entfernt. Die dichten Wolken und der Regen versperrten die Sicht zum Fluss. Es war, als würde eine dunkle Wand die Weser vor den Blicken der Menschen schützen. Die Dämmerung kam schnell, wie immer im Herbst. Ohne Lampe unten im Watt zu sein, das wäre jetzt lebensgefährlich. Hätte Hein in diesem Augenblick gewusst, dass Trine - um ihn zu erschrecken - ins Watt hinuntersteigen würde, er hätte das junge Mädchen bis Padingbüttel am Mantel festgehalten.
![]()
Keuchend, mehr stolpernd als gehend, erreichte Hein das untere Ende des Deiches. Die Lampe fiel ihm aus der Hand. Er hob sie wieder auf und wischte mit der Hand den Schlick vom Scheinwerfer. Blitzschnell war es geschehen, dass Trine losgerannt und im Dunkeln verschwunden war.
"Mal sehen, ob du mich durch Intuition und Gefühl wiederfindest!", hatte sie lachend gerufen.
Hein kannte Trine seit seiner Grundschulzeit. Er wusste, dass sie gern spottete und auch zu manch derbem Scherz aufgelegt war. Aber das hier ging einfach zu weit. Sie war ohne Licht ins Watt gerannt, was bei dieser Dunkelheit gefährlich war. Natürlich wusste Trine das. Sicher würde sie in Deichnähe bleiben und bald kichernd auftauchen, hoffte Hein.
"Hör auf mit dem Blödsinn und komm heraus, sonst gehe ich ohne dich zurück!", rief er.
Es kam keine Antwort. Ihm blieb nichts anderes übrig, als noch ein Stück ins Watt vorzugehen. Dabei leuchtete Hein in alle Richtungen. Die Batterien der Taschenlampe hatten bereits erheblich an Leistung eingebüßt, so dass er nicht besonders weit sehen konnte. Wahrscheinlich stand das Mädchen ganz in der Nähe und konnte nur angestrengt ein Lachen unterdrücken. Aber sie schien das Spiel weitertreiben zu wollen, denn außer dem entfernten Aufschlagen der Wellen war nichts zu hören.
Hein dachte an seine Ahnungen und er wünschte sich sehr, dass Trine endlich mit einem dummen Spruch auftauchen solle. Doch gleichzeitig wurde seine Befürchtung, dass sie nicht mehr, nie mehr, zurückkommen würde, immer größer. Das Licht der Lampe ließ weiter nach, nicht mehr lange, und es würde erlöschen. Hein überlegte verzweifelt, was er unternehmen könnte. Weit und breit gab es keine Menschenseele, die helfen könnte, denn. Padingbüttel war noch ein ganzes Stück entfernt. Der Ochsenturm lag zwar näher, aber der fast achtzigjährige Deichgraf würde keine große Hilfe darstellen - höchstens telefonieren könnte man bei ihm.
Hein rief noch einige Male nach Trine, ohne eine Antwort zu erhalten. Mittlerweile war sie schon über eine Viertelstunde verschwunden, was mit Sicherheit kein Spaß mehr war. Er hätte noch weiter ins Watt vordringen können, was aber die Gefahr in sich barg, sich zu verirren und dabei von der rasch näherkommenden Flut erwischt zu werden. Obwohl die Batterien der Lampe endgültig ihren Geist aufgaben, tastete sich Hein nach vorn.
![]()
Irgendwie hatte sie der Teufel geritten. Dieses bange Gefuchtel mit der Taschenlampe, dazu das unsinnige Gerede über düstere Ahnungen und verschwundene Feldmäuse... . Trine hatte noch nie Angst vor der Dunkelheit gehabt und im Watt kannte sie sich bestens aus. Wenn sie in der Nähe des Deiches blieb, so glaubte sie, könne ihr nichts passieren - die Flut war schließlich noch nicht sehr nah. Als ihr also die Idee gekommen war, Hein durch ein kurzes Verschwinden zu erschrecken, hatte sie ihr Vorhaben umgehend in die Tat umgesetzt. Schnell war sie die Böschung hinab gerannt und rund fünfzig Meter ins Watt gelaufen. Dann war sie stehen geblieben, um sich nicht weiter durch ihre Schritte zu verraten. Sie selbst konnte Hein aber sehen, denn der hatte schließlich die Lampe bei sich. Der Lichtstrahl war allerdings zu schwach, um bis zu Trine zu leuchten. Sie beobachtete Hein dabei, wie er unbeholfen die Böschung hinunterkletterte. Unten angekommen fiel ihm auch noch die Taschenlampe aus der Hand.
"Du ungeschickter Kerl", flüsterte sie und musste ihre ganze Kraft beisammen nehmen, um nicht lauthals loszulachen. Der arme Hein rief mehrmals, sie solle doch endlich zurückkommen. Nicht so laut, ich bin ganz in deiner Nähe, dachte sie amüsiert. Langsam wollte sie aber doch nach Hause, denn im nasskalten Watt herumzustehen, war nicht gerade ein Vergnügen. Nur einen Moment lang wollte sie Hein noch zappeln lassen, um dann laut Buh-rufend auf ihn zuzuspringen. Aber es kam anders, als Trine es sich gedacht hatte. So absurd waren Heins Ahnungen nämlich doch nicht.
Hein suchte noch eine Weile ohne Licht und verfehlte Trine dabei zweimal nur knapp. Er ahnte nicht, dass sie sich nicht mehr bewegen konnte. Schließlich gab er auf und rannte zum Ochsenturm zurück. Von dort aus alarmierte er die Küstenwacht.
![]()
Die Lähmung kam genauso heftig wie unerwartet. Trine verspürte eine nie gekannte Schwere in den Beinen. Als ihr auch noch schwindlig wurde, wollte sie nach Hein rufen, doch aus ihrem Mund kam nur ein tonloser Atemhauch. Innerhalb weniger Sekunden konnte sie sich nicht mehr bewegen, kein Finger ließ sich rühren - selbst die Zunge lag wie ein dicker, nasser Schwamm regungslos in ihrem Mund. Trine geriet in Panik, doch sie konnte nur bewegungslos verharren. Dieser Zustand dauerte eine halbe Stunde, die ihr wie eine Ewigkeit vorkam. Alle möglichen Gedanken und Ängste jagten ihr durch den Kopf: Sie schalt sich wegen ihrer Dummheit und fragte sich, ob sie für immer gelähmt bleiben würde.
Vielleicht waren ihre Muskeln durch die immer gleiche Haltung erschlafft, vielleicht gab es auch einen anderen Grund. Plötzlich schlug sie der Länge nach hin. Sie fiel auf die Seite und der nasse Schlick bedeckte ihre rechte Gesichtshälfte wie ein widerlicher Brei. Langsam kam wieder Gefühl in ihre Extremitäten, mit ein wenig Mühe konnte sie sogar die Finger bewegen. Trine überlegte, ob der Sturz die Ursache für das Nachlassen der Lähmung war. Vor allem aber war sie erleichtert darüber, sich mehr und mehr bewegen zu können. Etwas stimmte jedoch immer noch nicht. Ihr Gleichgewichtssinn schien gestört zu sein - sie befand sich im flachen Watt, hatte aber den Eindruck, auf einem Abhang zu liegen. Und dieser Abhang wurde zunehmend steiler! Es konnte keine Sinnestäuschung sein, denn es zog Trine in die abschüssige Richtung hinunter. Sie konnte sich noch nicht genügend bewegen, um sich dagegen anzustemmen. Ihr Körper kam ins Rollen,. Immer wieder wurde dabei das Gesicht in den Matsch getaucht. Schlick und Wasser liefen in Nase und Mund. Es roch und schmeckte nach Moder und Öl. Sie rollte schneller und schneller. Als sie glaubte, es würde überhaupt kein Ende mehr nehmen, wurde das Watt wieder flach und sie kam zum Stillstand. Trine lag auf dem Rücken im knöcheltiefen Wasser, um sie herum war es dunkel. Nur der Mond schien auf ihr verschmutztes, geschundenes Gesicht. Am Himmel zogen schwarze Wolken entlang, es hatte aufgehört zu regnen.
Sie war völlig verwirrt: Es gab hier keinen Berg, den sie hätte herunter rollen können - sie kannte das Watt. Dann die merkwürdige Lähmung, die jetzt so gut wie ganz nachgelassen hatte. Langsam erhob sich die junge Frau. Der Schlamm und die Nässe begannen ihren Körper gefährlich zu unterkühlen. Sie wollte jetzt so schnell wie möglich zum Ochsenturm zurück. Das herannahende Wasser - mittlerweile musste die Flut eingesetzt haben - war eine Bedrohung. Aber es war merkwürdigerweise keine Brandung zu hören, an der sie sich hätte orientieren können. In welcher Richtung lag nur der Deich?
Trine stolperte frierend und schluchzend umher.
"Hein, wo bist du denn nur? Hilf mir doch!", rief sie mit heiserer Stimme.
Ein großer Stein brachte das junge Mädchen zu Fall. Sie stolperte und landete erneut mit dem Gesicht im Watt. Sie stützte sich mit der linken Hand auf, doch ihr Arm glitt in einen kleinen Krater, in dem sich Hunderte von Insekten aufzuhalten schienen. Das muss ein liegengebliebenes Fischernetz sein, in dem Fische zappeln, dachte Trine. Es könnte aber auch etwas viel Ekelhafteres sein. Ihr Arm wurde bis zur Schulter ruckartig in den Krater gerissen und durch eine gewaltige Kraft abgetrennt. Sie betrachtete fassungslos den blutigen Stumpf. Das war das Letzte, was Trine Ehlers je erlebte.
![]()
Zwanzig Stunden nach Trines Verschwinden kehrte Hein nach Hause zurück. Selbstvorwürfe und sorgenvolle Gedanken hatten ihn nicht zur Ruhe kommen lassen.
Nachdem er vom Deichgrafen aus Hilfe herbei telefoniert hatte, war er selbst auf die Suche gegangen. Drei Rettungsboote der Küstenwacht waren bis in die frühen Morgenstunden unterwegs gewesen. Nach Sonnenaufgang war ein Hubschrauber erschienen, der ebenfalls vergeblich nach der Vermissten Ausschau gehalten hatte. Hein hatte der Polizei seinen Bericht zweimal zu Protokoll geben müssen. Jetzt, am späten Nachmittag, legte er sich durchgefroren und erschöpft ins Bett. Augenblicklich fiel er in einen tiefen, traumlosen Schlaf.
![]()
Fidje Ehlers war ein gedrungener, kräftiger Mann. Gewalttätigkeiten waren ihm durchaus zuzutrauen. Am frühen Morgen hatte er bereits eine halbe Flasche Apfelkorn getrunken. Wutentbrannt lief er die Dorfstraße entlang - sein Kopf war hochrot. Entgegenkommende Passanten grüßte er nicht, rempelte sogar manche an. Sein Ziel, ein Einfamilienhaus mit ungepflegtem Vorgarten, lag vor ihm. Er schnaufte vor Wut. Mit einem Fußtritt öffnete er die Gartenpforte und marschierte auf die Haustür zu. Er kam nicht auf die Idee, die Klingel zu benützen; er trommelte statt dessen mit der Rechten gegen die Tür.
"Immer mit der Ruhe. Was ist denn los?" Eine verschlafene Frauenstimme war aus dem Inneren des Hauses zu vernehmen.
"Fidje Ehlers hier. Los, mach auf! Ich muss was wissen." Er schlug nochmals mit der Faust gegen die Tür.
Eine dicke Frau öffnete. "Du, Fidje... was gibt es denn? Ist deine Tochter wieder aufgetaucht?"
"Das solltest du besser deinen Sohn fragen! Von dem will ich jetzt wissen, wo Trine steckt!"
Ehlers drückte die Tür ganz auf, schob sich an der Frau vorbei und betrat ungebeten das Haus. Er wusste, dass Heins Zimmer im Obergeschoss lag. Mit einer Wendigkeit, die man ihm nicht zugetraut hätte, stieg er die Treppe nach oben. Mit Schaum vor dem Mund stand er wenige Sekunden später vor Heins Bett und riss die Schlafdecke beiseite.
"So, Freundchen, nun packst du ganz schnell aus und verrätst mir, wo meine Tochter ist! Was hast du ihr angetan? Sag‘ es lieber gleich - ich kriege es sowieso raus!"
Hein, der noch nicht richtig wach war, schaute geschockt in das verzerrte Gesicht des hysterischen Mannes. Ehlers‘ Augen waren blutunterlaufen, sie blickten wild und wahnsinnig.
"Lass gefälligst meinen Sohn in Frieden, er hat in den letzten Stunden schon genug durchgemacht! Siehst du nicht, dass er vollkommen erschöpft ist?" Heins Mutter war ebenfalls heraufgekommen. Das hastige Treppensteigen hatte die korpulente Frau sehr angestrengt, sie keuchte und schwitzte. In der Hand hielt sie drohend einen Besen.
"Natürlich ist er erschöpft." Ehlers drehte sich zu ihr. "Trine hat sich bestimmt gewehrt. Und nun hau ab, du dickes Walross! Diese Sache hier geht nur mich und deinen Ableger was an!"
Er wandte sich wieder an Hein, der inzwischen aus dem Bett gesprungen war.
"Raus aus meinem Haus, oder ich rufe die Polizei!", rief Frau Hansen.
"Hol‘ sie doch! Bis die hier sind, bin ich mit euch beiden fertig", geiferte Fidje Ehlers ohne seinen Blick von Hein abzuwenden. "Na, Junge, zum Arbeiten bist du dir zu fein - aber meine Tochter vögeln, das willst du. Das werde ich dir austreiben!"
Ehlers holte zum Schlag aus. Frau Hansen sprang mit überraschender Schnelligkeit herbei und schlug Ehlers den Besenstiel mit aller Kraft auf den Kopf. Der stämmige Mann schrie laut auf. Heins Mutter hatte ihm eine Platzwunde zugefügt. Ehlers drehte sich um und wollte sich auf die dicke Frau stürzen, doch Hein war schneller: Von hinten griff er dem Betrunkenen in die Haare und zog ihn zu Boden. Frau Hansen wollte Ehlers, der jetzt auf dem Rücken lag, keine Gelegenheit zu weiteren Attacken bieten und schlug weiter mit dem Besen zu. Die Angriffslust verließ Trines Vater schlagartig. Schützend hielt er sich die Hände über den Kopf. Das Blut aus der Platzwunde lief ihm in die Augen.
"Aufhören, bitte hört doch auf!", bettelte er.
Frau Hansen war in Rage. Ihr Sohn musste ihr den Arm festhalten, sonst hätte sie noch eine Weile auf den am Boden liegenden Mann eingeschlagen. Hein packte Trines Vater unter die Schultern und zog ihn hoch.
"So, nun mach das, was meine Mutter dir gesagt hat: Verschwinde sofort aus dem Haus! Und noch eins, obwohl du es ohnehin nicht glauben wirst: Ich habe an Trines Verschwinden keine Schuld."
Ehlers wischte sich mit dem Ärmel das Blut aus dem Gesicht. Er torkelte auf die Tür zu und stieg die Treppe hinab. Hein ging hinterher, um sich zu vergewissern, dass der Mann auch wirklich das Haus verließ. Im Vorgarten drehte sich Ehlers sich noch einmal um.
"Du hast etwas mit dem Verschwinden meiner Tochter zu tun! Pass bloß auf, junger Hansen, ich erwische dich noch! Was immer auch du Trine getan hast, du wirst dafür bezahlen!"
Hein schlug die Haustür zu.
![]()
Die Sorge um seine Tochter und die gerade erlebte Schmach bei den Hansens taten weh. Um besser darüber wegzukommen, hatte sich Fidje Ehlers zwei kleine Flaschen Schnaps, sogenannte Flachmänner, am Kiosk gekauft. Die erste leergetrunkene Flasche warf er achtlos auf den Gehweg. Noch einige Minuten waren zu laufen, dann würde er den Deich erreicht haben. Fidje Ehlers benutzte einen einsamen Feldweg, um niemandem aus dem Dorf zu begegnen. Er lief schwankend. Auf seiner Halbglatze und im Gesicht klebte getrocknetes Blut. Links und rechts des Weges lagen ausgedehnte Felder, aber keine Kuh graste mehr auf ihnen. Die Bauern hatten ihre Tiere wegen der anhaltenden Kälte in die Stallungen geholt. Hundert Meter vor Ehlers lag der Deich. Von der Position des betrunkenen Mannes aus wirkte dieser wie eine gewaltige grüne Mauer inmitten der Felder. Aus seiner Jackeninnentasche zog Ehlers den zweiten Flachmann hervor und schraubte hastig den Deckel ab.
"Trine, gleich kommt dein Vater. Ich hole dich nach Hause, mein Deern", flüsterte er und trank die Flasche ohne abzusetzen aus. Der Flachmann landete in einem Graben, wo er langsam in einer braunen Brühe versank.
Zu Ehlers‘ Sorge um Trine kam auch sein schlechtes Gewissen, denn er war selten gut zu seiner Tochter gewesen. Mehr als einmal hatte er sie für ihre spitzen Bemerkungen geohrfeigt. Wenn er getrunken hatte, bekam das Mädchen mitunter auch grundlos eine richtige Tracht Prügel. Er verstand selber nicht, warum er solche Dinge tat. Wahrscheinlich wollte er vor sich selbst nicht zugeben, dass es ihm auf perverse Art Spaß machte, seiner Tochter wehzutun.
Vor einigen Jahren, es war Trines zehnter Geburtstag, daran konnte er sich noch genau erinnern, war er wieder einmal sturzbetrunken nach Hause gekommen. Seine Frau und die Kleine schliefen schon. Erst als er im Wohnzimmer verstreutes Konfetti, Luftballons und die Reste einer Sahnetorte sah, fiel ihm ein, dass seine Tochter Geburtstag hatte. Betrunken wie er war, glaubte er, es wäre eine gute Idee, das schlafende Kind zu wecken und ihm im Nachhinein zu gratulieren. So tapste er in Trines Zimmer. Sie lag halb aufgedeckt in ihrem Bettchen. Der Mond schien durchs Fenster und die Haut des Mädchens wirkte bläulich blass. Ehlers spürte, wie das Ding in seiner Hose schwoll. Schnell und heftig fasste er Trine zwischen die Beine. Das Mädchen schreckte hoch - ihre Augen blickten unglaublich entsetzt. Sie sagte kein Wort, sondern versteckte sich unter der Bettdecke.
Ehlers wachte damals am nächsten Tag auf der Wohnzimmercouch auf. Er verdrängte die Sache, und auch Trine redete niemals von dem Vorfall. Nur brachte sie ihrem Vater nie wieder Vertrauen entgegen, die beiden redeten fortan nur noch das Notwendigste miteinander. Das war bis zu Trines Verschwinden so geblieben. Er wollte dies wieder ändern: Er würde seine Tochter aus einer gefährlichen Situation retten und alles würde wieder gut. Seine schlimme Tat wäre endlich vergessen. Nun stand Ehlers vor dem Deich und begann mühsam, den steilen Grashang emporzusteigen. Er versuchte sich auszumalen, in was für einer Situation Trine stecken könnte. In seiner schmutzigen Phantasie gab es eigentlich nur die Vorstellung, dass dieser Hein Hansen ihr Gewalt angetan hatte.
Etwas hat sich hier im Watt abgespielt. Vielleicht hat der Dreckskerl sie vergewaltigt und irgendwo gefesselt.
Ehlers zog den Gedanken, dass Trine tot sein könnte, gar nicht erst in Betracht. Er lief den Deich in Richtung Ochsenturm entlang. Die Kälte bemerkte er nicht, der reichlich konsumierte Alkohol hatte seine Poren und Adern erweitert, er war kurz davor, sich eine Lungenentzündung zu holen. Unbeirrt lief er den Deich-Weg entlang und schaute grimmig in alle Richtungen. Auf der Weser herrschte reger Schiffsverkehr. Mehrere große Tanker und Handels-Schiffe kreuzten in beide Richtungen. Auch ein kleinerer Zerstörer der Marine war zu sehen. Der Deich aber war, wie immer zu dieser Jahreszeit und bei solchen Temperaturen, menschenleer. Als Ehlers rechts zur Landseite hinunterschaute, bemerkte er vor einer Wiese üppiges Strauchwerk, das ihm bis jetzt an dieser Stelle noch nie aufgefallen war. Die Büsche standen in voller Blüte. Dies war mehr als ungewöhnlich, schließlich war es Herbst und seit Wochen klirrend kalt.
"Endlich bist du da", flüsterte eine Stimme. "Hier bin ich."
Es war die Stimme von Trine. Fidje Ehlers schaute sich erstaunt um, nichts war zu sehen. Kam die Stimme aus dem Busch? Hatte Hein Hansen das Mädchen dort im Strauch versteckt? Der betrunkene Mann war sich plötzlich sicher, seine Tochter gefunden zu haben. Tränen der Freude liefen ihm über das blutverschmierte Gesicht - endlich war Trine wieder da. In diesen Busch hatte Hein Hansen sie also geschleppt - wahrscheinlich lag das Mädchen dort in Fesseln. Fidje Ehlers stolperte nach vorne, die Platzwunde auf seinem Kopf pochte heftig.
"Ja, komm, Vater komm!" Das Flüstern war wieder zu hören, diesmal lauter.
Endlich erreichte er das blühende Gestrüpp. Laut atmend blieb er stehen. Hastig schob er mit seinen klobigen Händen einige Zweige auseinander. Er hatte zwar gehofft, seine Tochter hier zu finden, als er jetzt aber ihr Gesicht vor sich hatte, erschrak er. Riesige Glubschaugen starrten ihn an. Seine Tochter sah aus, als hätte sie viel zu viel Rouge aufgelegt, das Gesicht wirkte merkwürdig verformt.
"Vater, bist du hier, um mich zu berühren? So, wie du es damals getan hast?", raunte eine dunkle Stimme, die nicht nach Trine klang.
Auch bewegte das Gesicht die Lippen nicht. Fidje Ehlers hielt das für eine Sinnestäuschung, bedingt durch seinen Alkoholgenuss. Bevor er antworten konnte, schoben sich die Zweige vollends beiseite und Trine trat hervor. Sie war vollkommen nackt.
"Ja, berühre mich! Oder stört es dich, dass ich nicht schlafe?"
Trines Vater machte verwirrt einige Schritte rückwärts. "Aber Mädchen, wie kannst du so reden? Ich war damals betrunken und wusste nicht, was ich tat!"
"Ja, du warst so betrunken, wie du es auch jetzt bist!"
Trines Aussehen wurde immer grotesker. Die Haut schien sich ständig zu bewegen. Der ganze Körper schimmerte rosa, wirkte schuppig. Die Haare waren nicht schwarz - sie waren hell, beinahe durchscheinend.
"Trine, was ist denn nur los mit dir? Du musst doch bei der Kälte frieren. Komm, zieh dir meine Jacke über! Bis zum Ochsenturm ist es nicht mehr weit, dort können wir uns aufwärmen", sagte Fidje Ehlers, war sich dabei aber nicht mehr so sicher, wirklich seine Tochter vor sich zu haben.
Kleine rosa Bröckchen fielen der merkwürdigen Gestalt aus dem Mund, das Gesicht veränderte sich immer mehr. Ein winziges Stück Fleisch löste sich aus dem Kopf und flog wie ein Geschoss auf Ehlers zu. Das Ding traf seine Wange und schien sich dort festzubeißen. Ehlers schrie vor Schmerz laut auf. Auf einmal war er überhaupt nicht mehr betrunken. Er wollte sich umdrehen und weglaufen. Doch immer mehr der winzigen rosa Stückchen lösten sich aus dem Körper der vermeintlichen Trine. Sie flogen blitzschnell auf den inzwischen in Panik geratenen Mann zu, bohrten sich durch seine Kleidung und fraßen sich tief in sein Fleisch. Die Beine wurden regelrecht von diesen Dingern übersäht. Bevor Ehlers stürzte, spürte er das Blut an seinen Waden herunterlaufen. Ihm wurde klar, dass er hundertfach durchbohrt und aufgefressen wurde. Das Wesen, das er für seine Tochter gehalten hatte, war nicht mehr zu sehen. Es war zu einem wabernden rosa Berg geworden, von dem aus immer neue Bröckchen auf ihn zusprangen.
Fidje Ehlers lag wimmernd am Boden. Schreien konnte er nicht mehr, denn sein Mund wurde von innen zerfressen. Er spürte die kleinen Teufel im Bauch, in den Augen, überall. Als sich die rosa Dinger durch die Schädeldecke bohrten und anfingen, sein Gehirn zu fressen, wurde es dunkel um Trines Vater. Der Tod erlöste ihn.
Auf seinem täglichen Weg zum Ochsenturm fand der Briefträger am nächsten Tag einen undefinierbaren Berg rohen Fleisches.
![]()
"Ich habe mir meinen alten Kopf darüber zerbrochen, was für die Ereignisse der letzten Tage die Ursache sein könnte", sagte der Deichgraf und ging zum Schreibtisch, der vor einem der großen halbrunden Fenster stand. Er öffnete die Schublade und holte einige Fotokopien hervor.
Hein, der auf dem Sessel inmitten des Zimmers saß, hörte gar nicht richtig zu, er war in Gedanken noch immer mit dem Verschwinden von Trine und Fidje Ehlers beschäftigt. Er schaute erst auf, als der Deichgraf ihm mit zitternder Hand einige Papiere auf den Schoß legte.
"Sieh dir das mal an, Hein! Vielleicht kann uns das weiterhelfen."
"Was sind das für Texte?"
"Kopien von Zeitungsausschnitten. Ein Bekannter, der beim Kieler Landboten arbeitet, war so nett, sie mir anzufertigen und vorbeizubringen. Als unten in Kuwait und im Irak der Golfkrieg tobte, gab es hier auf der Weser einen kleineren Zusammenstoß. Ein Schlepper rammte dabei ein U-Boot der US-Navy, es verlief aber alles recht glimpflich. Der Schlepper hatte nur ein paar Kratzer am Bug, das U-Boot bekam ein winziges Leck im Maschinenraum ab. Der Schaden des Kriegsschiffs konnte im Trockendock einer Bremer Werft innerhalb weniger Stunden provisorisch behoben werden. Die ganze Sache machte kaum Aufsehen, schließlich hatten Zeitungen, Radio und Fernsehen mit der Berichterstattung über den Golfkrieg alle Hände voll zu tun. Wer interessierte sich da schon für so einen kleinen Schiffszusammenstoß vor Padingbüttel?" Er zog die Augenbrauen hoch. "Auch ich habe die Angelegenheit nur so nebenbei zur Kenntnis genommen. Erst jetzt ist mir aufgefallen, dass die Sache zeitlich ziemlich genau mit dem Verschwinden der beiden Mannheimer übereinstimmt. Deshalb habe ich meinen Freund bei der Zeitung angerufen und ihn gebeten, mir die Berichte über den Vorfall zu bringen. Durch diese Artikel bin ich auf einige Merkwürdigkeiten gestoßen."
"Ehrlich gesagt, ich kann auf Anhieb keine Ungereimtheiten entdecken", sagte Hein, der mittlerweile in den Kopien blätterte.
Ich bin auch erst nach einer Weile darauf gekommen. Lies mal diesen Artikel!" Der Deichgraf zeigte auf das erste Blatt. Hein schaute sich den Bericht an:
Harmlose HavarieKiel/PadingbüttelGestern kam es auf der Weser, in der Nähe des malerischen Dorfes Padingbüttel, zu einem leichteren Zusammenstoß zwischen dem Schleppschiff "Geeste" und dem amerikanischen Unterseeboot "Corpus Christi". Beide Mannschaften kamen mit dem Schrecken davon. Einziges Ärgernis: "Ich habe mein Schiff letzte Woche neu anstreichen lassen und jetzt ist es schon wieder zerkratzt", so Gustav Bünting, Kapitän der "Geeste", gestern zu unserer Zeitung. Wie die Wasserschutzpolizei vermeldete, ist an der "Corpus Christi" ein winziges Leck entstanden, das in Bremen provisorisch verschweißt wurde. Das U-Boot wird morgen früh planmäßig nach Texas auslaufen. |
Hein blickte zum Deichgrafen auf. "Ein unbedeutender Unfall, wie die Zeitung schreibt. Was ist daran so ungewöhnlich?"
Der alte Mann legte die Stirn in Falten und setzte sich umständlich in seinen Sessel. Er räusperte sich:
"Ich bin ja, was die Seefahrt angeht, nicht ganz unerfahren. So fiel mir auf, dass weder der >Kieler Landbote< noch eine andere Zeitung erwähnte, dass die >Corpus Christi< ein Atom-U-Boot ist. Mit anderen Worten: die Schiffsschrauben werden mit einem kleinen Kernreaktor angetrieben. Ein Unfall hätte also eine Katastrophe auslösen können. Ich finde es äußerst seltsam, dass die Zeitung diesen nicht unbedeutenden Tatbestand einfach unterschlagen hat!"
"Vielleicht war es den Redakteuren einfach nicht bekannt und die Amerikaner selber wollten natürlich auch kein Aufheben um die Sache machen", meinte Hein.
"Wie gesagt, auch Radio und Fernsehen beachteten die Sache kaum. Hinzu kommt, dass die >Corpus Christi< für gewöhnlich auch fünf startbereite Kurzstreckenraketen mit nuklearen Sprengköpfen in ihrem Rumpf trägt, was jedem halbwegs gut informierten Journalisten bekannt sein dürfte. Aber auch darüber nirgendwo ein Wort, ich habe das überprüft."
"Seltsam ist das schon", räumte Hein ein. "Andererseits war der Golfkrieg im vollen Gange, Sie haben es selbst erwähnt. Die Zeitungsleute hatten genug damit zu tun, ihre Titelstorys zu schreiben. In den Medien wurde doch kaum über etwas anderes berichtet."
"Wenn die Sache damit zu Ende gewesen wäre, würde ich dir vielleicht zustimmen. Aber schau‘ dir das letzte von den Blättern an, die ich dir gegeben habe!"
Der Deichgraf zeigte auf die Fotokopie. Hein las den Artikel durch:
Verlängerter Aufenthalt für amerikanisches U-BootBremen/KielDie Besatzung der "Corpus Christi" konnte doch noch nicht, wie zunächst vorgesehen, die Rückreise in die USA antreten (der KIELER LANDBOTE berichtete). Das Boot machte einen Umweg in unsere Stadt, um hier auf dem Flottenstützpunkt der Bundesmarine durchgecheckt zu werden. Man sei zwar mit der vorläufigen Reparatur in Bremen sehr zufrieden gewesen, so Kapitän Joel Wilson zu unserer Zeitung, aber das Hochsicherheits?Trockendock in Kiel wäre für Kriegsschiffe wie seines ideal, um für die lange Überseefahrt gerüstet zu sein. Die Crew jedenfalls, so Wilson, freue sich darüber, noch eine Woche im schönen Norddeutschland zu sein. |
Auf dem Blatt war auch ein abschließender Bericht zu der Angelegenheit kopiert:
Abfahrt der Corpus ChristiKielFast unbemerkt von der Öffentlichkeit legte gestern in Kiel das U-Boot "Corpus Christi" ab. Es läuft aus, um seinen gleichnamigen Heimathafen in Texas zu erreichen. Dort wird die Besatzung einen längeren Landurlaub genießen. Das Boot war vor zwei Monaten auf der Weser mit einem Schlepper zusammengestoßen und danach in Bremen und Kiel repariert worden (der KIELER LANDBOTE berichtete). |
Hein legte die Kopien beiseite. "Das hat sich in der Tat ganz schön lang hingezogen. Erst sollten die Knaben am nächsten Tag auslaufen, dann sind sie doch zwei Monate geblieben. Vielleicht wollten sich die Jungs vor einem Kriegseinsatz am Golf drücken?"
Der Deichgraf schüttelte den Kopf. "Ein Einsatz stand meines Wissens niemals zur Debatte. Die >Corpus Christi< sollte tatsächlich in den Heimathafen zurück, die Besatzung hatte ihren Urlaub vor sich." Der alte Kapitän nahm die Kopien wieder an sich. "Kannst du dir etwas unter einem Hochsicherheits-Trockendock vorstellen?"
Hein zuckte mit den Schultern. "Ganz und gar nicht."
Der Deichgraf zog an seiner Pfeife, die einen angenehmen Duft im Raum verbreitete. "Es ist erstaunlich, dass dieses ominöse Hochsicherheits-Trockendock in der Zeitung erwähnt wird - da haben die sich bestimmt verplappert. Aber dadurch bin ich erst darauf gekommen, was wirklich passiert sein muss: Dieses Dock ist eine spezielle Einrichtung für die Reparatur von atomgetriebenen Schiffen. Ganz geheimnisvolle Sache, was dort im Einzelnen geschieht.. Steht alles unter direkter Aufsicht des Verteidigungsministeriums. Wegen einem kleinen Leck hat das amerikanische U-Boot da bestimmt nicht angelegt."
Hein setzte sich auf. "Sie denken, bei dem Unfall mit dem Schlepper ist Radioaktivität aus dem U-Boot entwichen?"
"Ich halte es für möglich. Auffällig ist jedenfalls, dass die beiden Mannheimer keinen Monat später verschwunden sind. Welcher Zusammenhang da bestehen könnte, musst du herausfinden!"
"Unvorstellbar - eine Beinahe-Katastrophe, verursacht von einem Atom-U-Boot! Ausgerechnet in der Nähe von Padingbüttel!" Hein konnte es nicht fassen.
"Zwei Touristen spurlos verschwunden, genauso Trine Ehlers und ihr Vater. Dann dieser mysteriöse Fleischfund des Briefträgers. Hein, du musst versuchen, Licht in dieses Dunkel zu bringen! Deine Ahnungen waren kein dummes Zeug. Ich kenne leider niemanden, der uns Glauben schenken würde." Der Deichgraf schaute mutlos.
"Ich denke, Ihre Recherchen können uns ein gutes Stück weiterbringen. Ich muss darüber nachdenken, was passiert sein könnte und was zu tun ist. Vielleicht sind die Verschwundenen an Radioaktivität gestorben - oder sie haben etwas gesehen, was sie nicht sehen sollten und bestimmten Leuten hat das nicht gefallen. Mir scheint mittlerweile alles möglich."
"Das denke ich auch, Hein", antwortete der Deichgraf. "Nur denke daran: Sei vorsichtig und informiere mich über alle deine Pläne! Vielleicht kann ich dir helfen."
Hein stand auf, um zu gehen. "Das versteht sich doch von selbst. Ich werde jetzt in Ruhe meine Gedanken ordnen. Dann telefonieren wir! Bis bald."
"Tschüs, mein Junge. Vergiss nicht, den Katonga-Stab mitzunehmen!"
![]()
"Post für dich. Ich glaube, es ist eine Vorladung von der Polizei." Hein bekam von seiner Mutter einen grauen Briefumschlag in die Hand gedrückt, als er das Haus betrat.
"In den letzten Tagen bist du dauernd beim Deichgrafen und kommst nur noch zum Essen und Schlafen hierher", sagte sie vorwurfsvoll.
Hein antwortete nicht darauf. Er streifte seine Schuhe ab und hängte seine Jacke an den Kleiderhaken. Den Umschlag öffnete er, während er wortlos die Treppe hinaufging.
"Dein Abendessen steht auf dem Küchentisch!", rief seine Mutter ihm nach.
Hein setzte sich auf sein Bett und schaute sich das Schreiben an. Es stammte tatsächlich von der Kriminalpolizei. Es wären noch einige Fragen offen, deshalb solle er in einer Woche im Kommissariat in Cuxhaven vorsprechen.
"Verdammt", flüsterte Hein, "denken die nun doch, dass ich schuld am Verschwinden von Trine und ihrem Vater bin?"
Unter dem Bett stand eine hölzerne Spielzeugtruhe, ein Relikt aus Heins Kindheit. Er zog sie hervor und hob den Deckel hoch. Unter alten Comic-Heften, Zinnsoldaten und Stofftieren deponierte er den Katonga-Stab, dann setzte er sich wieder aufs Bett. Hein dachte, dass es Zeit wäre, sich auf die Suche zu machen, und nahm sich für den kommenden Tag vor, während der ersten Ebbe ins Watt zu gehen. Hoffentlich würde der Katonga wirklich eine Hilfe sein.
Es war kurz nach zwanzig Uhr. Hein wollte heute früh ins Bett. Das Abendbrot würde er nicht anrühren, denn er hatte keinen Hunger und auch keine Lust darauf, diverse Diskussionen mit seiner Mutter auszutragen. Der Katonga-Stab ließ ihm keine Ruhe. Er holte ihn wieder hervor, nahm sich eine Paketschnur aus dem Schrank, wickelte ein Ende um den haitianischen Stock und das andere um sein Handgelenk. Es beruhigte ihn, diesen magischen Gegenstand fest bei sich zu wissen. Angezogen legte er sich auf das Bett. Die Anstrengungen und Aufregungen der letzten Tage ließen ihn schnell einschlafen.
![]()
Kurz darauf befand er sich in einer bunten Traumwelt. Vor seinem geistigen Auge erschien ein menschliches Gehirn. Es schwebte vor einem leuchtend-blauen Hintergrund frei im Raum. Diese vielen einzelnen Zellen... Im Laufe der Evolution zu einem großen Ganzen geworden...
Das Bild des Gehirns und die Gedanken verließen Hein. Verschwommene Eindrücke wechselten sich mit rätselhaften Bildern ab. Das Wesen - es schwimmt...
Irgendwann stoppt das Schwimmen, keine Bewegung ist mehr möglich... Es spürt die Artgenossen, auch in hoffnungsloser Situation... Das Außen ändert sich, ist nicht mehr träge... Das Wesen kann nicht mehr atmen... Dieser Schmerz des Sterbens...
Verschwitzt wachte Hein auf. Er lag unbequem mit dem Kopf auf dem Katonga-Stab. Müde nahm er ihn beiseite und bettete sich wieder ins weiche Kissen. Diese Eindrücke, hatte der Katonga sie ihm auf übernatürliche Weise zugänglich gemacht? Doch was hatten diese Erinnerungen zu bedeuten? Noch bevor Hein darüber nachdenken konnte, schlief er wieder ein.
Sein nächster Traum war unangenehm. Er sah sich an den Tag zurückversetzt, an dem ihn die flüsternden Stimmen tief ins Watt, in die Flut locken wollten. Wieder stand er dort und fühlte sich in Trance versetzt. Doch diesmal holte ihn kein Düsenjäger in die Realität zurück. Diesmal ging er dorthin, wo die Stimmen ihn haben wollten. Und der Weg war beschwerlich. Er wusste, dass es ein Traum war. Aber so sehr er sich auch anstrengte, er konnte nicht aufwachen.
Unvermittelt befand er sich auf einer Treppe Es war die hölzerne Treppe, welche zur Aussichts-Plattform des Ochsenturms führte. Doch sie nahm kein Ende. Hein lief und lief. Die Wände schoben sich an ihm vorbei, er erreichte kein Ziel. Seine Beine und Füße schmerzten. Er wollte stehen bleiben, doch er konnte der einschmeichelnden Aufforderung dieser flüsternden Stimmen nichts entgegensetzen. Laufen, laufen, laufen..
Waren es wirklich die Stufen im Ochsenturm, auf denen er sich befand? Fühlte es sich nicht eher wie Asphalt oder Gras an, was seine Füße da berührten? Der Traum hatte unvermittelt ein Ende.
![]()
Frierend erwachte Hein. Sein Kopf lag auf einer nassen, glitschigen Fläche. Jeanshose und Sweatshirt waren von Feuchtigkeit durchdrungen. Blinzelnd erhob sich Hein und sah über sich den Halbmond. Er war im Freien - er war im Watt! Wie war das möglich? Suchend blickte er um sich. Weder die Weser noch der Deich waren auszumachen. Im Schlamm zeigte sich eine frische Fußspur, die zu ihm führte. War er im Schlaf gewandelt? Sein ganzer Körper schmerzte. Irgendetwas musste tatsächlich im Schlaf Macht über ihn gewonnen haben, etwas, das genug Kraft hatte, um sein Unterbewusstsein so zu beeinflussen, dass es den Körper hierher hatte befehlen können.
Er wusste nicht, wie tief er sich im Watt befand und wie spät es sein mochte. Wahrscheinlich war es weit nach Mitternacht. Der Mond schien einigermaßen hell, die Sterne leuchteten an einem klaren Himmel. Es herrschte keine absolute Dunkelheit, aber der Deich und die Weser lagen außerhalb der Sichtweite. Hein hörte das Rauschen der Brandung, das Wasser befand sich hinter ihm. Dadurch stand fest, dass er geradeaus gehen musste, um ans Festland zu gelangen. Er war froh darüber, den Katonga-Stab bei sich zu wissen, und wurde einen Moment enthusiastisch: Vielleicht gäbe es jetzt die Möglichkeit, dem Geheimnis auf die Spur zu kommen!
Doch die Kälte brachte ernüchternde Gedanken mit sich. Heins Kleidung war vollkommen durchnässt, die Temperatur lag nur knapp über dem Nullpunkt. Hier würde er nicht lange bestehen. Es konnte momentan nur das Ziel geben, sich aufzuwärmen und trocken anzuziehen. Er beschloss, heimzugehen. Als er jedoch das erste Mal auftrat, jagte eine Welle stechenden Schmerzes von der Fußsohle bis zum Unterschenkel. Hein hatte keine Schuhe an und während des Schlafwandelns schien er unvorsichtig über scharfe Steine gelaufen zu sein, dabei war die rechte Fußsohle verletzt worden. Langsam und stöhnend humpelte er weiter.
Hein hoffte, die Richtung nicht zu verlieren, nicht allzu weit vom rettenden Deich entfernt zu sein. In seinem Kopf begann es zu dröhnen, das Rauschen der Wellen schien auf einmal aus allen Richtungen zu kommen. Vor seinen Augen begann das Bild zu verschwimmen, trotzdem lief er noch schneller. Der Schlick unter seinen Füßen wurde immer feuchter, eigentlich ein Zeichen dafür war, dass er dem Fluss - von dem er weg wollte - wieder näher kam. Wie war das möglich? Die Symptome von Panik breiteten sich in seinem Körper aus: Ein unangenehmes Hitzegefühl wanderte vom Brustkorb in den Kopf. Hein nahm alle Willenskraft beisammen und versuchte, bei klarem Verstand zu bleiben. Er blieb stehen, sein Herz klopfte bis zum Hals hinauf. Das Dröhnen in Heins Kopf verschwand so schnell, wie es gekommen war, sein Blick war nicht mehr getrübt. Aber das, was er sah, gefiel ihm ganz und gar nicht: Vor ihm lag tatsächlich wieder die Weser. Er drehte sich um und erkannte im matten Mond- und Sternenschein das Watt, dessen Weite sich in der Dunkelheit verlor.
"Verdammt, das gibt‘s doch nicht!", flüsterte Hein, noch immer vor Anstrengung keuchend.
Er war die dem Fluss entgegengesetzte Richtung gelaufen und hätte demzufolge ans Festland gelangen müssen. Doch jetzt stand er am Wasser. Wie war das passiert? Er war sich sicher, nicht im Kreis gelaufen zu sein. Eine unabsichtliche Richtungsänderung von einhundertundachtzig Grad wäre ihm, der mit dem Watt bestens vertraut war, niemals unterlaufen. Wellen schwappten über seine Füße. Die Flut hatte eingesetzt, der Fluss rückte rasch näher. Hein kamen die vielen Menschen in den Sinn, die im Watt umgekommen waren, weil sie die Orientierung verloren hatten. Manche wurden vom herannahenden Wasser überrascht und ertranken, andere waren auf immer im Schlick versunken. In Wassernähe konnte das Watt gefährlich sein wie das Moor.
Hein schaute in den nächtlichen Himmel und suchte nach einem Sternbild, an dem er sich orientieren konnte. Er fand den Großen Bären und prägte sich dessen Position ein. Damit müsste es möglich sein, zum Deich zurückzukommen Er drehte sich um und ging wieder in die Richtung, in der das rettende Festland lag. Hein konzentrierte sich darauf, exakt geradeaus zu laufen und schaute mehrmals zurück, um sich davon zu überzeugen, dass seine Fußspur in einer geraden Linie verlief. Immer wieder suchte er am Himmel den Großen Bären. Doch das Sehen bereitete ihm bald Schwierigkeiten. Die Sterne verschwammen immer mehr vor seinen Augen, bis sie schließlich zu einem undefinierbaren Lichtschleier wurden. Nach einer kurzen Weile, die Weser hinter ihm war längst im Dunkeln verschwunden, hörte er wieder dieses Dröhnen. Die Brandung war nicht mehr zu orten, es rauschte aus allen Richtungen. In Heins Därmen begann es zu reißen und zu kneifen. Es war unmöglich, weiterzugehen. Er sank auf die Knie und atmete tief ein. Langsam ließen die Schmerzen nach, die Sinne wurden wieder klar. Als er die Augen aufschlug, war es wie ein Schock: Er befand sich erneut vor dem Fluss! Eine unfassbare Kraft brachte es fertig, ihn daran zu hindern, das Watt zu verlassen. Das Wasser kroch auf ihn zu und die erste Welle schlug gegen seine Knie. Die Flut würde ihn mit sich reißen, wenn er nicht von hier fort kam!
"Verdammt!" Er sprang auf und hob den Katonga-Stab. "Wenn du mir helfen kannst, dann tu es jetzt!"
Wieder drehte Hein sich um. Trotz seiner Schmerzen begann er zu rennen. Den Katonga hielt er dabei wie ein Bajonett vor sich. Er starrte geradeaus und hörte nur noch das schmatzende Geräusch seiner Schritte. Schweiß rann ihm in dicken Rinnsalen von der Stirn, aus dem Mund keuchte der Atem. Es war wie eine Beschwörung. Hein glaubte mit aller Kraft daran, dass er den Deich mit Hilfe des Stabes doch noch erreichen würde. Er lief nur kurze Zeit, aber es kam ihm wie eine Ewigkeit vor.
Dann blieb er stehen. Er wischte sich mit dem Ärmel über das Gesicht und blickte nach vorn. Was er sah, erschien ihm wie ein Segen. Nur wenige Meter entfernt lag der Deich. Die gewaltige Silhouette streckte sich nach links und rechts, um jeweils im Dunkeln zu verschwinden. Der Wall bohrte seine Steine bis tief den Schlick, weiter oben stand das Gras ruhig im fahlen Licht des Mondes. Der Katonga lag warm in Heins Hand. Er hatte die Macht gebrochen, die den Jungen im Watt hatte festhalten wollen!
Die Schnitzereien auf dem Stock waren im Dunkel nur undeutlich zu erkennen, der Silberbeschlag funkelte. Die Brandung wurde lauter, das Wasser kam näher. Im hellen Mond- und Sternenlicht würden die ersten Wellen bald zu erkennen sein. Vom Deich aus wäre es jetzt ein Leichtes gewesen, wieder nach Padingbüttel zu kommen. Aber warum davonlaufen, jetzt, wo der Katonga bewiesen hatte, dass er eine Hilfe war? Offensichtlich war das Unheimliche doch nicht allmächtig.
Hein fühlte gegenüber Trine und den anderen Toten die Verpflichtung, der Sache ein Ende zu bereiten. Etwas hatte die Macht gehabt, ihn hier herzulocken und beinahe umzubringen - doch der Katonga-Stab hatte die Situation geändert. Es gab keinen Grund mehr, sich ausgeliefert zu fühlen. Hein fror nicht - die Anstrengung hatte ihn erhitzt. Der Wunsch, dem Unheimlichen gegenüberzutreten, wurde übermächtig. Er drehte sich und um machte einige Schritte ins Watt.
"Was bist du? Komm endlich raus und hör auf mit deinen verdammten Tricks! Zeige dich mir - von Angesicht zu Angesicht!", rief Hein.
Die lauten Worte hallten in der Dunkelheit. Die aufschlagenden Wellen waren bereits zu erkennen. Zwischen Deich und Weser mochten vielleicht noch einhundert Meter Watt liegen. Wenn das Grauen fassbar war und sich nur im Watt bewegen konnte, müsste es jetzt sehr nahe sein. Hein drehte sich, den Katonga-Stab ausgestreckt vor sich haltend, im Kreis. Er konnte nichts erkennen. Hinter dem Deich zeigten sich rötliche Streifen. Der Morgen begann zu dämmern. Die Dunkelheit der Nacht wich langsam dem Licht des jungen Tages. Ein Geräusch ließ Hein zusammenzucken... Gluckern und Schlürfen... . Es klang, als ob der letzte Rest einer schaumigen Badebrühe im Abfluss verschwand. Möglicherweise verursachte ein kleiner Siel die Geräusche - im Watt nichts ungewöhnliches. Vielleicht war es auch etwas anderes... ?
Mit seinen tauben Füßen tastete sich Hein langsam vor. Mittlerweile war kein Gluckern mehr zu hören, das Geräusch war zu einem hoch schwingenden Ton geworden. Hein dachte unwillkürlich an ein feuchtes Glas, dessen oberer Rand mit einem Finger zum Vibrieren gebracht wurde. Er nahm den Katonga-Stab wie eine Keule in Anschlag. Das Geräusch wurde schriller. Unerträglich schneidend - ein imaginäres Glas schien in Heins Kopf zu zerspringen - mit der freien Hand hielt er sich ein Ohr zu. Obwohl es zunehmend heller wurde, war die Quelle des Lärms nicht auszumachen. Leere auf dem Deich, Leere auf dem Wasser... . Nichts Auffälliges war zu sehen.
Es wirkt im Verborgenen. Suche es dort, bevor es dich überrascht! Das Unheimliche lebte im Watt und verbarg sich dort vor den Menschen, daran hatte Hein keinerlei Zweifel. Aber jetzt war er im Watt und konnte dieses Etwas nicht finden. Plötzlich kam ihm ein Gedanke: Natürlich! Es ist im Watt, steckt tief im Schlick und ist deshalb nicht zu sehen.
Als seien seine Gedanken ein Signal gewesen, verstummte der hohe Ton. Eine Weile klingelte er noch in Heins Ohren nach. Er schüttelte kurz den Kopf und konzentrierte sich auf den Boden. Der Schlick glänzte bösartig. Kleine Steinchen schienen zu merkwürdigen Gesichtern formiert zu sein, winzige Wasserlachen funkelten feindselig. Im Katonga-Stab machte sich ein leichtes Pulsieren bemerkbar. Hein glaubte erst an Einbildung, aber vom Stock ging tatsächlich ein sanftes Ziehen aus, dem er schließlich folgte. Der Katonga führte ihn nahe an den Fluss, und dort lag der Stab wieder reglos in der Hand. Hein schaute nach vorne und sah einen dunklen Kreis am Boden. Wie eine rotierende Scheibe schob sich das Gebilde durch den Schlamm. Langsam kam das Ding auf Hein zu. Ruckartig stoppte es und bewegte sich wieder ein Stück zurück.
Es schien, als ob es abschätzend nach einem Angriffspunkt Ausschau hielt. Das undefinierbare Ding konnte sich nicht entschließen und Hein befürchtete, dass es wieder verschwinden könnte, noch bevor er gehandelt hatte.
Die Sonne war noch nicht gänzlich hervorgekommen, aber es war bereits hell genug für Hein, um sich sicher im Watt zu bewegen. Er rannte auf den Fleck zu und blieb in etwa drei Meter Entfernung stehen. Das Ding wirkte wie ein kleiner Krater, der sich auf seltsame Weise im Watt verschieben konnte - eine trichterartige Vertiefung, die von innen heraus leuchtete, abwechselnd rosa und lila. Innerhalb dieses Kraters bewegte es sich wie in einem Wespennest. Hein beugte sich vor und schreckte gleich wieder zurück: Der Rand der Vertiefung stülpte sich aus wie ein gieriges Fischmaul. Grauer Schleim quoll dabei hervor, begleitet von einer nach Verwesung stinkenden Dampfwolke.
"Pfui Deibel!", keuchte Hein und schlug mit dem Katonga nach dem Rand des Kraters. Die Vertiefung zog sich rechtzeitig zurück und entkam dem Schlag.
Blubbernd wanderte der Krater rund zehn Meter in Richtung Deich. Hein wollte dem merkwürdigen Gebilde nachsetzen, aber ein warmer Lufthauch und merkwürdige Gedanken hielten ihn zurück. Es waren Gedanken, die er bereits aus einem Traum kannte:
Oh, dieser Schmerz... Keine Bewegung mehr möglich... Ein anderes Außen... Einen Teil von sich verlieren...
Starker Schmerz begleitete diese Gedanken und Hein war für einen Moment unaufmerksam. Schnell schüttelte er sich, um wieder klar denken zu können. Die Vertiefung im Boden war zurückgekommen und befand sich jetzt genau vor ihm. Sie hatte größere Ausmaße, als es anfänglich schien, ein erwachsener Mensch konnte leicht in diesem Krater verschwinden. Hein starrte in die Öffnung und wäre tatsächlich um ein Haar hineingestürzt. Er riss sich zusammen, trat einen Schritt zurück und schlug mit voller Kraft mit dem Katonga-Stab gegen den Rand des Kraters. Es sprühte Funken.
Rotes Licht erhellte für Sekunden die Umgebung und ein spitzer Schrei kam aus der Vertiefung. Der Krater machte einen fünf Meter langen Satz zurück und spie dabei seinen grauen Schleim. Die Sonne kam nun vollends hervor und es wurde blendend hell. Hein schaute auf den Katonga-Stab: Der Silberbeschlag war schwarz und verbogen. Vom Krater, der sich jetzt wie verrückt drehte und dabei aus dem Schlamm kam, musste eine enorme Hitze ausgegangen sein. Das Ding wurde zu einem kegelförmigen Gebilde und erhob sich über dem Watt. Die Luft um die merkwürdige Erscheinung knisterte, kleine blaue Blitze zuckten kurz auf. Ein großer, rosa Kreisel bildete sich, der um seine eigene Achse rotierte. Instinktiv machte Hein einige Schritte nach hinten, konnte aber seinen Blick nicht von dem obskuren Ding abwenden.
Nachdem der Kegel seine offensichtlich volle Höhe von fast vier Metern erreicht hatte, hörte er auf, sich zu drehen. Die rosa Oberfläche blieb dennoch in Bewegung. Der beissende Geruch war unerträglich. Hein kam es vor, als würden unzählige winzige Tiere auf dem Ding herumkrabbeln. Es wurde Zeit herauszufinden, ob dieser Kegel noch Angst vor dem Katonga-Stab hatte. Bevor sich Hein in Bewegung setzen konnte, erreichte ihn erneut eine ungestüme Welle von Gedanken.
Das ist eines der Wesen, die uns ermorden... Lasst uns töten... Rache nehmen...
Eine tiefe Müdigkeit befiel Hein. Er schaffte es nicht mehr, sich zu bewegen. Die Lider fielen ihm vor die Augen. Bilder und Gedankenwellen, wie er es aus dem Traum her kannte, besetzten seinen Kopf.
Es gibt eine natürliche Schwingung zwischen den Wesen... Sie kennen den Schmerz der Artgenossen, die ein anderes Außen ertragen mussten, die sich nicht mehr bewegen, nicht mehr atmen konnten, die einen Teil ihres Körpers verloren...
![]()
Hein sah in einer Vision zwei Schiffe kollidieren. Er wusste, das es das U-Boot und der Schlepper waren, von denen der Deichgraf berichtet hatte.
Tausende der Wesen bewegen sich im Schwarm... Radioaktivität verändert Schwingungen... Die Evolution wird übersprungen... Die Wesen kommunizieren... Viele unbedeutende Einheiten, kaum sich selbst bewusst, werden zu einem großen, einzigen Bewusstsein... In diesem Bewusstsein ist fest verankert, was die Menschen den Einzelwesen angetan haben und ständig antun...
"WACH AUF! WACH AUF!", schrie es wie aus dem Nichts. Hein erschrak. Kam die Stimme vom Katonga-Stab? Hein biss sich auf die Unterlippe, um hellwach zu werden. Der Schmerz brachte ihn tatsächlich in die Realität zurück. Er schmeckte das Blut, das von seiner Lippe in den Mund lief.
Der Kegel war in dem kurzen Augenblick der Unaufmerksamkeit nahe an ihn herangekommen. Hein starrte das Ungetüm an und erkannte endlich, was sich da auf ihn zu bewegte. Es waren Krabben, unglaublich viele Krabben - es mussten Tausende sein! Jetzt wurde ihm schlagartig die Bedeutung der Visionen klar. Die Berichte vom Unfall des Atom-U-Bootes und die Traumbilder fügten sich zu einer Auflösung zusammen: Die >Corpus Christi< hatte einen Teil des Flusses radioaktiv verseucht, dadurch wurde ein Krabbenschwarm kontaminiert. Selbst diese niedrige Lebensform hatte ein kollektives Bewusstsein, das durch Mutation jetzt personifiziert und verkörpert worden war. Und: Das Ergebnis bewegte sich auf Hein Hansen zu!
Erschrocken stellte er fest, dass seine rechte Hand leer war. Der Katonga-Stab war heruntergefallen! Hein schaute auf den Boden, nichts war zu sehen. Langsam kam das Krabbenmonster näher. Hastig stocherte Hein mit den Füßen im Schlamm. Er stieß gegen etwas Festes und sah erleichtert den verzierten Griff. Schnell bückte er sich und zog den Stab aus dem Schlick. Als er sich wieder aufgerichtet hatte, stand das Monster direkt vor ihm. Hein reagierte schnell. Er stieß den Katonga-Stab tief in die zappelnden Krabben, aus denen das merkwürdige Wesen bestand. Im selben Augenblick überkam ihn eine erneute Gedankenwelle. Es war wie ein Keulenschlag. Eine Energiewelle packte ihn, riss ihn hoch und schleuderte ihn zehn Meter durch die Luft. Hein hörte sich selber schreien. Der Katonga-Stab schnellte aus seiner Hand. In der Luft machte Hein einen Salto und landete schließlich auf dem Rücken im flachen Wasser. Schlamm und Wasser spritzen auf und bedeckten sein Gesicht. Eine Welle stechenden Schmerzes jagte durch seinen Oberkörper. Hein hatte sich am Schulterblatt verletzt. Er stützte sich stöhnend mit der linken Hand ab, um sich aufzurichten.
Mühevoll und mit schmerzverzerrtem Gesicht erhob er sich.
Hein versuchte den rechten Arm zu bewegen, aber er konnte es nicht. Keuchend wischte er sich mit der Linken den Schmutz aus dem Gesicht. Über sich hörte er ein lautes Zischen und sprang geistesgegenwärtig beiseite. Gerade rechtzeitig: Neben ihm schlug ein brennender Gegenstand ein. Im knöcheltiefen Wasser erlosch das Feuer sofort. Hein erschrak, als er das angesengte Geschoss sah: Ein kleiner Holzstumpf, der einst zum Katonga gehörte! Es war das einzige, was von dem magischen Stab aus Haiti übriggeblieben war. Heins Schultern sanken mutlos herab. Es war sinnlos, dem Monster verletzt und unbewaffnet gegenüberzutreten. Jetzt konnte er sein Heil nur noch in der Flucht suchen.
![]()
Die Weser hatte den Deich fast erreicht. Zwischen Fluss und Deich gab es nur noch zwanzig Meter freiliegendes Watt. Leise und jämmerlich erklang wieder der Schrei des Monsters, um gleich darauf zu verstummen. Nicht weit von sich entfernt sah Hein die Krabben, sie rotierten jetzt im Wasser. Ihre kegelhafte Form hatten sie fast verloren - es schien mit ihnen zu Ende zu gehen. Der Katonga-Stab hatte sie also doch erledigt! Das Gebilde bog sich in alle Richtungen, einzelne Krabben fielen heraus und trieben auf den Wellen. Noch einmal bäumte es sich auf, bevor es sang- und klanglos im Fluss unterging. Einige Luftblasen erinnerten noch für Sekunden an die Erscheinung. Hein, der schon knietief im Wasser stand, schaute sich um. Der Deich lag nur wenige Meter hinter ihm. Es war sehr früh, kein Mensch war unterwegs.
![]()
Heins Verletzungen schmerzten. Am ganzen Körper machte sich die Kälte bemerkbar. Zum Ochsenturm, mich aufwärmen... , dachte er, ihm wurde es schwummrig vor den Augen. Hein vermutete, dass er schon seit einer ganzen Weile stark unterkühlt war. Seine Beine wollten ihm nicht mehr gehorchen. Er kippte nach hinten und blieb erschöpft im Wasser sitzen, das ihm bis zum Brustkorb reichte. Schüttelfrost durchlief seinen Körper.
Zum Deich sind es höchstens zwanzig Meter - das kann ich noch schaffen, sagte er in Gedanken zu sich selbst.
Er gab sich einen Ruck, doch er kam nicht wieder hoch. Statt dessen fiel er zur Seite und sein Kopf tauchte unter Wasser, er schluckte eine gehörige Menge des salzigen Wassers. Dann kam er wieder an die Luft und hustete beinahe eine Minute. Er spuckte noch einige Male aus und schaffte es endlich, sich zu erheben. Wie in Zeitlupe lief er in Richtung Deich. Zehn Meter.... Fünf Meter... Die Steine waren zum Greifen nahe.
Ein schrilles Geräusch übertönte plötzlich alles. Hein drehte sich um. Meterhohe Gischt, von Dampf umgeben, spritzte aus dem Wasser hervor. Etwas Rötliches war in diesem Gebilde zu erkennen. Das Krabbenmonster existierte immer noch! Es kam aus dem Dampf hervor, deutlich geschrumpft, aber es lebte. Der Katonga-Stab hatte die ursprüngliche Gestalt der Kreatur erheblich reduziert: der Kegel war nur noch einen Meter hoch. Aber das Monster schien beweglicher als zuvor zu sein - und es ging sofort zum Angriff über. Hein machte einige Schritte rückwärts. Das Krabbenmonster rotierte wie wild und kam rasend schnell auf ihn zu. Das hohe Summen wurde unerträglich laut - Hein wandte sich zur Flucht um. Er erreichte den unteren Teil des Deiches, rutschte aber auf den algenverschmierten Steinen aus. Laut schreiend vor Schmerzen landete er auf seinem verletzten Arm. Das Krabbenmonster berührte seinen rechten Fuß. Nun hat es mich, dachte Hein verzweifelt.
Er schaute nach hinten und erschauerte: Das Monster nahm die Gestalt von Trine Ehlers an und verwandelte sich fließend in deren Vater. Der grinste diabolisch, hielt Heins Fuß in den Klauen und steckte ihn sich in den weit aufgerissenen Mund. Hein spürte, wie das Bein langsam inmitten der Krabben versank. Ein Schmerz wie der Stich von tausend Nadeln durchfuhr ihn. Seine nach vorn ausgestreckte Hand wurde im selben Moment von etwas Warmem, Faltigem berührt. Hein fühlte sich von allen Seiten umschlungen. Er schloss die Augen, alle Hoffnung hatte ihn verlassen..
"Schnell, Junge, dreh‘ dich zur Seite, ich ziehe dich gleichzeitig nach vorne!", rief eine Stimme, die Hein schon sehr oft gehört hatte. Er konnte es erst glauben, als er hinschaute: Der alte Deichgraf stand vor ihm und hatte ihn bei den Händen gepackt.
"Worauf wartest du?"
Der Deichgraf riss mit einer für einen Greis ungewöhnlichen Kraft an den Armen des jungen Mannes. Hein begriff endlich und drehte sich zur Seite. Es gab ein lautes Plopp und der im Krabbenmonster gefangene Fuß war wieder frei. Hein raffte sich auf und machte sofort einen Sprung zur Seite. Sterne tanzten vor seinen Augen. Der Fuß sah arg geschunden aus und blutete aus mehreren Wunden. Aber das Monster gab noch nicht auf. Es wurde zu einem Kegel, immer noch mit dem Kopf von Fidje Ehlers. Der Mund war zu einem klaffendem Maul mit hässlichen Rattenzähnen geworden. Der Deichgraf stand nun neben Hein auf der abschüssigen Steinfläche des Deiches. Das Monster kam bedrohlich auf die beiden zu. Erst jetzt bemerkte Hein den Blecheimer, der neben dem Deichgrafen stand.
Dem alten Mann stand der Schweiß auf der Stirn. Eilig bückte er sich und nahm den Deckel des Eimers ab. Eine brodelnde Flüssigkeit wurde sichtbar, sie verbreitete einen beißenden Gestank. Der alte Kapitän hob den Behälter an. Das Ehlers-Krabbenmonster riss das gewaltige Maul auf, bereit, den Deichgrafen zu verschlingen. Doch dieser schwang den Eimer und schüttete den Inhalt in den Rachen des Monsters.
"Lass es dir schmecken, es ist Säure!", rief er triumphierend.
Der Schrei des Monsters ertönte ein letztes Mal in ungeheurer Lautstärke - diesmal klang das Gebrüll überrascht. Hein wollte sich die Ohren zuhalten, doch er wurde schmerzhaft an seinen verletzten Arm erinnert. Noch einmal strahlte das Ungetüm eine verzweifelte Gedankenwelle aus. Das Ungeheuer schien maßlos erstaunt zu sein: Es wollte Rache für Artgenossen nehmen und erlitt nun selbst eine vernichtende Niederlage. Das Ding zerfiel buchstäblich in seine Einzelteile. Die meisten der Krabben wurden von der Säure zerfressen. Das Gebilde konnte sich nicht mehr zusammenhalten, überall auf dem Deich lagen zuckende Schalentiere. Der Deichgraf machte sich daran, sie zu zertreten. Hein verstand sofort und begann damit, die Überbleibsel des Wesens mit seinen nackten Füßen zu zerquetschen. Der Schmerz interessierte ihn nicht mehr.
![]()
Der Deichgraf legte seine warme Winterjacke um den am ganzen Körper zitternden Jungen.
"Ob wir alle erwischt haben?", fragte Hein.
"Selbst wenn nicht: Einzelne Krabben können nichts ausrichten, im Gegensatz zu dem Schwarm, der von der Radioaktivität zusammen geschweißt wurde. Und diese große Einheit haben wir zerstört."
Der alte Mann hatte Schwierigkeiten, den Deich zu ersteigen.
"Ich kann Sie nicht stützen, ich glaube, mein Arm ist gebrochen", sagte Hein.
"Macht nichts, die paar Meter werde ich schon schaffen", erwiderte der Deichgraf. Als er endlich oben angekommen war, bewegte sich sein Brustkorb heftig auf und ab.
Zusammen mit Hein schaute er noch einmal auf die Weser, die das Watt jetzt vollständig bedeckt hatte. Das Wasser war ruhig und glänzte friedlich in der Morgensonne.
Eine Möwe flog kreischend über die erschöpften Männer hinweg. Die Rotoren eines Hubschraubers wurden hörbar. Der Deichgraf schaute zum Himmel.
"Die Jungs von der Küstenwacht kommen im richtigen Moment. Mit deiner Verletzung und der Unterkühlung gehörst du dringend in ein Krankenhaus."
"Wer hat die wohl gerufen?", fragte Hein.
"Ich. Die ganze Nacht über hatte ich ein ungutes Gefühl! Ich konnte einfach nicht schlafen. Als endlich die Sonne aufging, nahm ich mir sofort meinen Feldstecher und schaute aus dem Fenster. Einen halben Kilometer von mir entfernt sah ich jemanden im Watt herumspringen. Mir war klar, dass nur du das sein konntest, deshalb rief ich Hilfe herbei."
Der Hubschrauber landete, und der Deichgraf musste schreien, damit Hein ihn verstehen konnte. "Natürlich konnte ich trotzdem nicht tatenlos in meiner Stube hocken. Ich hatte noch einen Eimer mit purer Säure im Keller - du weißt ja, dass ich das Zeug zum Putzen benutze. Ich dachte mir, dass man damit wohl gegen jeden Gegner etwas ausrichten könnte und nahm es mit."
"Aber was soll ich nur erzählen?" Hein zeigte auf den Arzt, der jetzt aus dem Hubschrauber stieg.
Der Deichgraf dachte einen Moment nach. "Sag einfach, wir beide wollten in aller Frühe eine Wattwanderung machen, dabei bist du den Deich hinuntergestürzt!"
Hein schaute wenig begeistert. "Na, ob der Arzt das glaubt?"
Der Deichgraf lächelte: "Es wird ihm und den Leuten im Krankenhaus nichts anderes übrigbleiben."
Der Notarzt hatte sie erreicht. Er hörte sich die Erklärung des zerschundenen Hein an und schiente provisorisch den gebrochenen Arm.
Hein wandte sich noch einmal an den Deichgrafen: "Vielen Dank, ohne Sie wäre ich nicht mehr am Leben!"
"Nichts zu danken, mein Junge! Wir sehen uns, wenn du wieder auf dem Posten bist!"
Hein gab ihm die Jacke zurück und stieg mit dem Arzt in den Hubschrauber. Die Rotoren sprangen an und die weißen Haare des Deichgrafen wirbelten durcheinander.
Der alte Mann winkte Hein noch hinterher, dann machte er sich auf den Weg zum Ochsenturm.
ENDE |